
Friedel Klee 1954

11-11-10
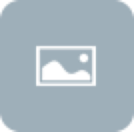
"Wie es auch kommt, wir tragen´s mit Geduld,
denn wer zur See fährt, ist selbst dran schuld."
Im Jahre 1954 segelte Friedel Klee mit seinen beiden Freunden Winfried Koll (später immer wieder als "Jolly" erwähnt - 1969 Deutscher Meister auf der Hansa-Jolle) und Helmut Albers mit einem Kielschwert-Kreuzer von Kiel nach Stockholm.
Friedel Klee war schon in seinen jungen Jahren ein begeisterter Segler aber auch interessanter Schreiber, der über diesen Törn auf 80 Seiten alles niedergeschrieben und festgehalten hat.
Glücklicherweise hat "Jolly" den sehr interessanten und ausführlichen Törnbericht für diese Seite zur Verfügung gestellt - dafür sei ihm ganz herzlich gedankt!
So hängt es, schön in Holz geschnitten in der Kajüte einer Yacht, mit der ich als Crew die Nordsee befuhr. Wie wahr es ist, hatte ich schon 1952 erfahren, als ich mich mit meinem schnellen 20 qm Jollenkreuzer "Hai" zum ersten Mal als Kaptein gen Dänemark und Schweden segelte.
Auf dieser, an sich erfolgreichen Reise zeigte sich aber,was auch von berufener Seite immer betont wurde: ein Jollenkreuzer ist nicht für die offene See geeignet. Hai´s Segeleigenschaften waren hervorragend. Sobald aber Seegang von einiger Höhe auftrat, wurde es unangenehm, ja gefährlich. Da ich aber nicht zuviel "daran schuld" sein mochte, andererseits das Seefahren auch nicht lassen kann, wurde er kurz entschlossen - wenn auch wehmütig - verkauft.
Es kostete einige Wochen intensiver Suche, dann war er da
Vagant
Sein Vater, Karl Vertens, hatte ihn 7,85 m lang und 2,23 m breit mit spartanisch einfacher Einrichtung für sich selbst 1949 in Eiche und Mahagoni gebaut. Seine Segeleigenschaften übertrafen merkwürdigerweise die des Jollenkreuzers. Jedenfalls gelang es "Hai" bei späteren Ausgleichregatten nie, auch nur annähernd an VAGANTheranzukommen, selbst mit ausgetauschter Besatzung nicht. VAGANT kreuzte eine schlechthin unübertreffbare Höhe: bei ruhigem Wasser und mäßigem Wind bis zu 35º am Wind. Daneben war er so kursstabil, dass man die Pinne belegt stundenlang alleine lassen konnte. Experten sagen zwar, dass, wie alles seinen Preis hat - große Höhe und Kursstetigkeit mit schlechter Wendigkeit bezahlt werden muss. Nun - VAGANTdrehte nicht auf dem Teller wie ein Jollenkreuzer, zumindest aber genau so schnell wie ein gleich großes reines Kielboot.
Alles wurde aber übertroffen durch das Verhalten in seinem eigentlichen Element: der offenen See. Wenn hier noch verglichen werden soll, dann nur mit wesentlich größeren Booten. Sicher und trocken schwamm er wie eine Ente obenauf. "Blaues" Wasser an Deck gehörte zu den ausgesprochen seltenen Ereignissen, auch bei grobem Wetter.
Nach einer solchen Lobeshymne müssten nun eigentlich auch die Nachteile zur Sprache kommen. Es klingt gewiss nach Übertreibung, aber selbst bei schärfster Kritik bleibt nicht viel zu bemängeln.
Da wäre vielleicht das Deck, ein Teakholz-Scheuerdeck, der Traum (aber auch Alptraum) aller Segler, die noch Sinn für die althergebrachten Formen des Bootsbaues haben. Auch ich muss diese Vorliebe mit einem ständigen Kampf gegen kleine aber unangenehme Leckagen bezahlen. Ein nur 25 mm starkes Stabdeck ist nun mal nicht ganz dicht zu bekommen. An diese Tatsache wurde ich bisweilen sehr handgreiflich erinnert. So machte ich mir einmal - allein an Bord, müde, Hungrig - eine Tasse Kaffee. Es duftete herrlich, als das sprudelnde Wasser auf das braune Pulver geschüttet wurde. Schnell ordentlich Milch hinein, viel viel Zucker (wie ich es zum Entsetzen vieler erfahrener Kaffeetrinker so liebe) aus der offenen Dose im Verpflegungsspind, umgerührt, ein tiefer, genießerischer Zug und - fast hätte das Frühstück so den Weg so vieler Seefahrerfrühstücke angetreten. Der Kaffee schmeckte einfach entsetzlich. Das heißt, "schmecken" kann man das, was ich fühlte eigentlich gar nicht mehr nennen. Und der Grund? Die Zuckerdose stand im Spind unmittelbar unter dem Deck. So hin und wieder drangen ein paar Tröpfchen durch und fielen in den Zucker, der beim nächsten Sonnenschein wieder trocknete. Das Übrige mag sich jeder selbst vorstellen.
Und dann der Schwertkasten. Das Schwertfall lief durch ein sinnreich angeordnetes Rohr auf eine kleine Wind. Da das Rohr mit dem sonst so verschlossenen Schwertkasten und damit mit dem Außenwasser in Verbindung stand, wurde beim Heben und Senken des Bootes im Seegang oft heftig Luft ein- und ausgeatmet. Dabei entstanden Geräusche, wie sie vielleicht mal ein asthmatischer Saurier von sich gegeben haben könnte. Dieses ununterbrochene, trotz aller Lappen, die wir dem Urvieh in den Hals stopften, andauernde Gurgeln, Rülpsen und Schlürfen war eine fast ernst zu nehmende Beeinträchtigung unserer Seetüchtigkeit. Jedenfalls bekamen bei dieser Musik viele Malzeiten einen vatalen Beigeschmack.
Das Schwert war wohl der einzig wirklich schwache Punkt des Bootes. Es bestand aus zu dünnem Material und machte uns viel Kummer und Arbeit dadurch, dass es oft klemmte und nur durch Aufwendung roher Gewalt wieder in seine richtige Lage gebracht werden konnte.
So, das wäre das Boot, und nun kann die Reise losgehen. Das heißt, zunächst muss ich noch die Besatzung vorstellen.

Winfried Koll, 24 Jahre, Elektriker,
vermutlicher Erfinder der mit saftigen Reden
vermischten eisernen Ruhe.

Helmut Albers, auch 24 Jahre, bisher noch unbefahren

. . . und ich als Schipper und Navigator.
Die umfangreichen Vorarbeiten wurden von jedem auf dem ihm gemäßen Gebiet geleistet. Um die Transportkosten niedrig zu halten, wurde für einen Spediteur eine Fahrt außer der Reihe organisiert: eine Ladung Sperrholzplatten nach einem Ort in Küstennähe, Entladung am Himmelfahrtstage durch die Besatzung, für die Rückfahrt eine Ladung Apfelsinen ab Hamburg. Eine dolle Kungelei.
Das Schwierigste war die Verladung des Bootes am Möhnesee. Es gibt dort noch immer keinen geeigneten Kran. Das heißt, so etwas gibt es schon. Man muss sich nur einen entsprechenden Kranwagen kommen lassen. Die Verladung geht dann sehr schnell. Da das aber nur 300 DM kostete, und wir uns mit so kleinen Beträgen gar nicht erst aufhalten wollten, machten wir die Verladung auf althergebrachte Weise. Unter der bewährten Leitung unseres Bootsbauers Paul Schmelz wurde ein 3-to-Anhänger auf der "alten Arnsberger Straße" mit Hilfe eines Motorbootes ins Wasser gezogen. Als der Wagen tief genug unter Wasser war, wurde das Boot darauf geschoben. Dann ließ der LKW seine 90 PS ziehen, dass es eine Freude war, bis langsam die Seitenwände des Anhängers an der Wasseroberfläche erschienen. Aber wie sie erschienen! Wir trauten unseren Augen kaum. Der Wagen war die Böschung der seit 40 Jahren unter Wasser liegenden alten Straße hinuntergerutscht und kam nun mit 45º Schlagseite hoch, auf ihm der Bootsrumpf. Der Lastwagen zog, was er konnte, aber bald erwies sich die Überlegenheit einer der stärksten Naturgewalten über die Technik. Der Schlamm hielt sein Opfer derart fest, dass jedes Ziehen vergeblich war. Der Anhänger musste wieder unter ins Wasser gezogen und das Boot wieder abgeladen werden, bevor eine neuer Versuch gemacht werden konnte. Aber auch diese Mühe war vergeblich. Der Kampf dauerte mehr als 10 Stunden, dann erst hatten wir das tückische Element - falls man den Schlamm so nennen kann - besiegt. Eine nähere Beschreibung dieser Schlacht ist wohl nicht mehr möglich. Als wir aber endlich einigermaßen fahrbereit auf der Straße standen, hatte VAGANT weder Ankerkette noch Reservetauwerk. Ganz zu schweigen von den Drahttrossen, die zu kurzen, handlichen Stücken zerfetzt waren. Der Lastwagen, eine schwere Seilwinde und ein großes Motorboot hatten dieses Vernichtungswerk vollbracht. Der Anhänger sah aus wie ein Lehmklumpen mit Rädern.
Wir fuhren nach Neheim, wo VAGANTbeim Sägewerk Wrede mit einem richtigen Kran in wenigen Minuten auf den großen, nagelneuen Anhänger umgeladen wurde, der ihn nach Kiel bringen sollte.
Bald war alles verstaut und - endlich - um 10 Uhr abends rollten wir los. Für die Nacht machten wir es uns an Bord bequem. Alles schaukelte und zitterte zwar ein wenig und besonders das Porzellangeschirr klirrte, aber die Autobahn war immerhin so glatt, dass wir etwas schlafen konnten.
Irgendwann wurden wir wach. Der Lastzug hatte die Autobahn verlassen und rumpelte irgendwo durch die Heide nordwärts. Wir dösten vor uns hin. Plötzlich schreckten wir auf. Da war doch etwas mit dem Boot?
Ich kroch schnell einmal auf das Vorschiff. Nichts Besonderes zu sehen. Mir viel nur auf, das das Boot merkwürdig leicht und locker wippte. Schnell mal unters Boot - da hatte ich die Bescherung: die Rumpfstützen vorn und achtern begannen zusammen zu brechen und der Kiel arbeitete sich langsam aber sicher in den Boden des Anhängers. Mehrere Bodenbretter waren schon gebrochen, andere angeknickt. Es lief mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich sah das stolze Schiff schon zerschmettert auf der Landstraße liegen, ringsherum Schafe, Kinder mit dem Finger in der Nase, Kühe und schadenfroh grinsende Bauern. Wir wollten doch noch bis Stockholm und nicht in der Heide einen Brennholzhandel anfangen. Also: Großalarm! Leicht gesagt. Nachdem ich meine schlaftrunkenen Kameraden auf den Beinen hatte, versuchten wir den Wagen zum Stehen zu bringen. Wir pfiffen, wir tuteten mit dem Nebelhorn und brüllten. Es dauerte eine ganze endlose Weile, bis uns der Fahrer endlich bemerkte. Er bremste, dass uns das Ende der Reise nun wirklich nahe schien. VAGANT steckte seine Nase in die Höhe, das Gestell krachte - aber wir standen.
Nachdem wir aufgeatmet und der Fahrer seine virtuose Schimpfkanonade über den zerbrochenen Boden beendet hatte, stellten wir fest, dass der Schaden - wie meistens - längst nicht so schlimm war. Es hatte sich nur mal wieder die "Natur selbst geholfen".
Beim verladen des Bootes war der Rumpf vorn und achtern abgestützt und der Kiel mit einer Bohle so unterlegt worden, dass das Deck annähernd waagerecht stand. Das behagte VAGANT nicht. der Kiel, der den festen Mittelpunkt des ganzen Rumpfes darstellte war gewohnt, die Last des übrigen Bootes allein zu tragen. Mit einer festen Unterlage, versteht sich. Da die fehlte, schaffte er sie sich selbst. Er zerbrach die Stützen und wühlte sich durch die zollstarken Bohlen der Ladefläche, bis er auf den darunter liegenden stählernen Verstrebungen festen Halt fand. Hier setzte er sich mit leicht gesenktem Bug befriedigt hin und wippte (siehe oben) nur manchmal weich und locker. Das war es also. Wir waren etwas beruhigter, obwohl wir der Sache noch nicht ganz so trauten. Wir fuhren weiter, setzten aber eine Wache unter den Rumpf mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Lärminstrumenten, denn: nichts Genaues weiß man nicht . . .
Aber VAGANT war zufrieden und benahm, sich fortan manierlich. Um 11 Uhr erreichten wir Kellinghusen, unser erstes Ziel. Hier mussten wir unsere Holzladung abliefern.
Nachdem wir im schweiße unseres Angesichtes fleißig Sperrholzplatten aller Größen und Stärken geschleppt hatten, ging es weiter nach Kiel.
Hier klappte alles sehr gut. Der Obmann der Kreuzerabteilung des Deutschen Seglerverbandes, Herr Sorgatz, hatte gut vorgearbeitet. Trotz des Feiertages stand ein Kran nebst Kranführer zur Verfügung, der uns das Boot ins Wasser setzte.

Damit auch diese Sache ein wenig spannend wurde, fehlte zunächst mal eine passende Drahttrosse. Der Kranführer wurde schon ungeduldig, bis wir nach Absuchen eines riesengroßen Schrottplatzes etwas annähernd Passendes fanden. Es waren mehrere kurze Enden, die wir irgendwie zusammensteckten. Als VAGANT darin hing, verspürte er solche Sehnsucht nach dem lang entbehrten Seewasser, dass er seine Nase vorwitzig nach vorn streckte. Es knirschte kurz und hässlich, aus dem rostigen Draht stieg brauner Staub, und das Boot hing 50º nach vorne geneigt nur noch in einem, verdächtig mürben Ende. Uns stockte der Atem. Vorsichtig wie eine Eierkiste schoben wir das Schiff über die Pier hinaus, noch einmal rasselte der Kran, VAGANT senkte sich - und endlich schwamm er. Gott sei Dank.

Schnell nahmen wir den Motor an Bord und brachten ihn an. Ein Wunder geschah: er lief und brachte uns bis zum Olympiahafen. Dort wurde aufgeriggt und Rein-Schiff gemacht.
Am nächsten Tag segelten wir zum Bootshafen, ließen Tauwerk und Persenninge etwas überholen und kauften ein paar Reserveschoten, Fender und sonstige Ausrüstung. Anschließend ging es weiter nach Holtenau zur Transitübernahme. Wir bestellten von all den zollfreien Herrlichkeiten was das Herz begehrte: Schokolade, Zigaretten, Kaffee, Kakao, Zucker, Gebäck. Vor allem auch eine Batterie schöner bunter Buddel: Rum (echter, kein Verschnitt), Bols Liköre, franz. Cognac, Whisky. Zum Schluss blieb noch ein Kontingent von einigen Flaschen übrig. Wir berieten, und man empfahl uns "Eau de vie". Aber nicht zum selber Trinken! Nur für Schwedenmägen geeignet. Die Flasche DM 1,30. Wir versprachen, uns nicht selbst an dem edlen Tropfen zu Vergreifen und bestellten einige Flaschen. Was das für Folgen hatte kommt später. Zunächst einmal bekamen wir von dem ganzen Segen nichts. Die ganze Becherung wurde in Kartons verpackt, mit der für Taklings so gut geeigneten Zollschnur verschnürt und plombiert an Bord genommen.
Nach kurzem Aufslippen und Reparatur kleinerer Transportschäden bei Scharstein in Strande ging es am 29. Mai um 15.20 Uhr endlich los.
Als letzte Formalität ließen wir uns in Laboe die Zollplomben öffnen und kreuzten dann bei strahlendem Sonnenschein nach Nordosten aus der Förde. Wir passierten das Ehrenmal und öffneten die erste Flasche. Sie hatte ein schönes bunte Etikett, dass wir zu spät merkten, was wir getrunken hatten: Eau de vie. Zunächst rührte uns das wenig. Der Urlaub hatte endlich begonnen, der erste Kurs war abgesetzt, das Wetter war schön und das Schiff lief gute Fahrt. Die Stimmung war großartig. Der Abend kam mit einem herrlichen Sonnenuntergang. Dann die Nacht. Es wurde still an Bord. Der Wind kam noch immer von Nordosten, also genau dorther, wo wir hinwollten. Die Wachen wechselten regelmäßig; schließlich graute der Morgen. Rings um uns die endlose Weite der See. kein Land in Sicht, obwohl es doch hier nicht allzu weit entfernt war. VAGANT machte gute Fahrt gegen die von Osten heranrollende Dünung. Allmählich versammelte sich die Besatzung im Cockpit. Aber welch ein jammervoller Haufen war aus der stolzen Crew geworden! Seegang und Eau de vie hatten ihr Werk getan. Neptun bekam seinen Tribut, wobei sich diesmal selbst der Schipper nicht ausschließen konnte. Die Stimmung war ziemlich down.
Voraus kam das Feuerschiff Fehmarn-Belt in Sicht. Um 10 Uhr hatten wir dies erreicht. Einsam und etwas unheimlich dümpelte es in der See. Wir wendeten und liefen - gegen die Regel - knapp in Luv des Schiffes vorbei, um die bei dem weiter auffrischenden Ostwind vermutete Westströmung zu ermitteln. Wir hatten uns nicht geirrt, sie war ziemlich erheblich. So kamen wir nicht weiter. Wir wollten ja nach Osten. Aber bei der gesunkenen Kampfmoral auch noch den Strom auszukreuzen, das erschien uns für heute etwas zuviel. Wozu gab es schließlich Häfen? Da lag zum Beispiel oben in der Ecke de Seekarte "Lübecker Bucht" Rødbyhavn, gar nicht weit von unserem Standort. Wenn wir eine Weile weiter mit Nordkurs liefen, mussten wir es bald erreichen. Ein Kreuzschlag unter der Küste war wohl nicht ganz zu vermeiden, denn bei dem noch immer zunehmendem Ostwind konnten wir den Hafen nicht ganz anliegen.
Da war auch schon die Küste, weit weit weg, flach. Langsam, viel zu langsam für unsere Ungeduld kamen wir näher. Der Wind nahm weiter zu. Wir refften das Großsegel und setzten eine kleine Fock. Da - vor uns ein Hafen. Aber was war das - er lag in Lee und nicht, wie erwartet, in Luv. Sollte ich mich verrechnet haben? War es ein anderer Hafen? Auf der Karte sah ich nichts dergleichen. Egal - dachte ich - Navigation ist, wenn man trotzdem hinkommt. Wenn eine richtige Einfahrt mit Mole da ist, an Land Häuser und der übliche dänische Fahnenstangenwald, dann wir es schon richtig sein.
Nun - es war nicht ganz richtig. Kurz vor der Einfahrt wurde das Wasser eklig hell: Grundsicht! Da geschah es auch schon, im nächsten Wellental setzte VAGANT sich hart auf den Grund. Er stand sofort. Die nächste See hob ihn wieder, er nahm etwas Fahrt auf, aber dann wieder ein Stoß. So gut es ging, nahmen wir das Schwert hoch. Es war schon verbogen und klemmte. Noch einmal setzte VAGANT auf - diesmal leichter - dann waren wir frei. Unmittelbar vor uns lag die Einfahrt. Der Seegang rollte quer davor her. Ich steuerte das Boot genau am Luv-Molenkopf hinein. VAGANT verbeugte sich und stand wieder. Diesmal weich im schlammigen Grund. Die nächste Welle hob ihn an, bevor er wieder Fahrt aufnehmen konnte, setzte sie ihn ein Stück in Lee erneut in den Schlamm. Wieder eine Welle - das gleiche Spiel. So kamen wir nicht vorwärts. Die Segel wurden geborgen. Die klotzigen Steine der Mole kamen bedrohlich näher. Ich sprang ins Wasser und brachte nach Luv einen Anker aus. Damit er hielt, mussten wir uns noch weiter nach Lee versetzen lassen. Als endlich Druck auf die Trossen kam, und der Anker - wenn auch langsam slippend - hielt, waren die Steine unmittelbar neben uns.

VAGANT sitzt fest. Helmut steht am Ufer und kann nur tatenlos zuschauen.
Einige junge Männer, die gerade zum Schwimmen in der Nähe waren, kamen uns zur Hilfe und versuchten, das heftig tanzende Boot von den Steinen abzuhalten - in der Brandung eine lebensgefährliches Unterfangen. Endlich kam aus dem Hafen ein Fischerboot. Man warf uns eine Kokostrosse herüber und VAGANT drehte unter dem Zug des starken Motors langsam seinen Bug in den Wind. Unmittelbar hinter uns die Steine, Ankertrosse geslippt, Ruder ohne Wirkung. Jetzt entschied sich das Schicksal des Schiffes. Fiel es nach Backbord, ab so trieb es - diesmal unaufhaltsam auf die Steine. Aber Rasmus hatte ein Einsehen. VAGANT drehte nach Steuerbord und damit von der Küste ab. Noch einmal setzte er sich hart auf. Etwas ratlos schauten wir hinter einigen kleinen, mit Kupferbronze gestrichenen Holzstückchen her, die nach oben kamen und schnell abtrieben. Eilig setzen wir etwas Segel. Nicht ganz einfach, denn die Fallen waren durch das Dümpeln vollständig vertörnt. Gleichwie, ein paar Quadratmeter kamen hoch und VAGANT nahm etwas Fahrt auf.
An Bord herrschte "Zustand". Helmut hatte beim Abtreiben den Anschluss nicht mehr bekommen und stand an Land. Statt seiner hatten wir einen jungen Dänen in Badehose an Bord, der aber tatkräftig mit anpackte. Wir gingen daran, aufzuklaren. Aber was war as? - VAGANT rollte so seltsam schwerfällig hin und her, - da, Wasser im Schiff! Klares Seewasser, nicht nur ein bisschen Bilgenbrühe. Schnell runter, Anker weg. Ich suchte fieberhaft. Aus den Ritzen der Luke zum Achterpik drang Wasser. Ich riss sie auf. Sofort ergoss sich ein breiter Strom ins Cockpit. Ich riss die Sachen aus dem Stauraum. Endlich - unter unserem Kartoffelsack sah ich es durch die Ritzen der Bodengräting hellgrün heraufschimmern. Sack raus, Gräting zur Seite, einen großen Aufnehmer in das Leck. Da hätte ich nicht tun sollen. Zwei Planken waren von außen geknickt und eine davon zwischen zwei Spanten heraus gebrochen. Daher die Holzstücke. Als ich nun von Innen den Lappen hereindrückte, brachen auch die Bruchstücke der zweiten Planke weg. Das Leck war nun etwa 20 x 20 cm groß. Das Wasser strömte nur so herein. Ich richtete mich auf und sah, dass das ganze Brückendeck bereits überflutet war. In der Kajüte stand das Wasser bis in Höhe der Polster. Das Boot richtet sich im Seegang nur noch widerwillig auf, die Wellen spülten über Deck. Wir begannen, mit allen verfügbaren Gefäßen zu pützen. Das dänische Fischerboot tanzte neben uns auf und ab. Die Besatzung rief, wir sollten rüberkommen. Nein, noch nicht. Es entspann sich eine abgerissene Verhandlung über die Möglichkeit, unser Boot in Lee der Leemole zu standen. Nein, meinten die Dänen, dort wo das Wasser ruhig schien, sei es zu flach und daneben gleich wieder Steine. Einschleppen? Zwecklos; euer Boot liegt schon zu tief. Kommt rüber! - Noch nicht! -
Im Boot schwamm alles durcheinander: Seekarten, Tauwerk, Handbücher, Esswaren, Kleidung. Einige höhere Wellen wuschen über´s Kajütdach und brachten uns noch mehr Wasser ins Schiff.
Endlich eine Idee: Lecksegel! Mit fliegenden Händen schlug Winfried die Fock ab. Mir schien es stundenlang zu dauern. Endlich war sie klar. Achtern wurde eine Leine unter dem Heck durchgeholt, das Segel daran gesteckt, unter das Heck gezogen und steif geholt, so dass das Leck bedeckt war. Der Wassereinbruch ließ sofort nach, ja, er hörte fast ganz auf. Wir rissen die Bodenbretter im Cockpit los und pützen bis zur Erschöpfung.
VAGANT kam langsam hoch. Erneute Verhandlung mit den Fischern. Jetzt waren sie bereit, das Einschleppen zu versuchen. Eine Leine wurde geworfen, das Fischerboot zog an. Wieder blieben wir in der Einfahrt stecken. Schnell setzten wir das inzwischen aufgeklarte und ausgereffte Großsegel. Das Boot legte sich hart über, einige Wellen, das Fischerboot und Zug von Land taten den Rest. Unendlich langsam glitt VAGANT über die Barre in ruhiges Wasser. Wir atmeten auf. Ein wenig zu früh, denn beim Rutschen über die Schlammbarriere hatte sich das Lecksegel verschoben. Erneut drang Wasser ein. Diesmal war es klein klares Seewasser, sondern faulige aufgerührte Schlammbrühe, die sich in unserer gemütlichen Kajüte breit machte. Es gelang jedoch noch rechtzeitig, das Boot in den hintersten Teil des völlig verschlammten Hafens zu bringen. Hier holten die Fischer das Heck mit einer Talje so weit auf, das das Heck über Wasser kam.

Der "Zustand" an Bord war nunmehr absolut. Unter tatkräftiger Hilfe der Fischer und unserer gekaperten Passagiers wurde erst einmal gelenzt. Die hierbei von den Dänen verwandten, primitiven, aus einfachen Stücken Rohr, etwas starkem Draht und Putzwolle oder Lumpen selbst gemachten Pumpen waren einfach unübertrefflich. Sie brachten wesentlich mehr, als unsere eingebaute zierliche Messingpumpe. Vor allem aber verstopfte sie nicht. Rings um das Boot legte sich eine große Schaumschicht von aufgelöstem Waschpulver.
Wir räumten das Boot vollständig aus. Die gesamte Einwohnerschaft lief zusammen und half. An Land entstand eine regelrechtes Warenlager. Bald flatterten an allen Wäscheleinen und Netztrockengestellen der kleinen Fischersiedlung unsere zum Trocknen aufgehängten Sachen. Von allen Seiten wurden wir zum Kaffee eingeladen. Unser gekaperter Däne - Finn Schiødt Christensen aus Nakskov - erwies sich als außerordentlich nützlicher Helfer. Er sprach englisch und etwas deutsch, so dass er gut für uns dolmetschen konnte.
Als die meiste Arbeit getan, das Boot gesichert war, und der Trubel sich etwas gelegt hatte, gingen wir an den Strand, um uns ein wenig zu erholen. Die Sonne schien und der Wind hatte nachgelassen. Ich nahm das Logbuch mit, um einen Bericht über das Geschehene zu verfassen. Gleich zu Anfang kamen mir Bedenken. Ich rechnete unseren Kurs nach und stellte fest, dass wir unmöglich in Rødbyhavn sein konnten. Auf unserer Karte war andererseits kein weiterer Hafen in dieser Gegend zu finden; äußerst merkwürdig. Ich sah mich also gezwungen, etwas ähnliches wie das schwedische Verfahren der "pasnavigering" oder Tütennavigation anzuwenden. Dieses Navigationsverfahren geht zunächst davon aus, dass ein Segler selbstverständlich immer genau weiß, wo er sich befindet. Sollte die Überzeugung nun aber doch einmal ins Wanken geraten, so errechnet er seinen ganz genauen Standort aus dem Mittel zwischen den als bekannt vorauszusetzenden Verpflegungsvorräten seines Bootes und der sorgfältig zu konstruierenden Notwendigkeit, etwas im nächsten Laden kaufen zu müssen. Hierbei muss ganz besonders der Neugierfaktor der Besatzung ausgeschaltet werden. Man läuft dann die nächste Insel an, geht in den Laden an der Ecke und kauft z.B. eine Tüte Gebäck. Zurück an Bord sagt man nach kurzem Blick auf die Aufschrift der Tüte: "Sven Nilson, Mjölkffär, Sandwig", esst Obst und ihr bleibt gesund" verächtlich zu seiner Crew: Habe ich es nicht schon vorher gesagt, der Kuchen in Sandwig taugt nichts! . . . Denn der Schipper weiß immer ganz genau Bescheid. Er muss sich nur hüten, an ein Filialgeschäft zu geraten, dessen Zentrale vielleicht in Stockholm liegt.
Leider gab es weit und breit keinen Laden und Gebäck hatten wir selbst. So musste ich die allerletzte aller Navigationsmethoden anwenden: fragen. Ich ging am Strand entlang, bis ich einen eleganten Badeanzug mit einer netten jungen Dame darin entdeckte, hielt mich an meinem Logbuch fest und fragte sie, ob sie wohl zufällig englisch oder gar deutsch spräche. Sie konnte beides. Als ich sie nun bat, mir zu sagen, wo ich war meinte sie, ich wolle sie aufziehen. Sie sah mich verdutzt und zweifelnd an. Erst als ich ihr unsere Geschichte erzählt hatte, erklärte sie es mir. Wir waren in Kramnitze, einer winzig kleinen Fischersiedlung. Das, was wir für einen Hafen gehalten hatten, war früher Ausgang des in den zwanziger Jahren trockengelegten Rødby-Fjords. Im hinteren Teil des "Hafens" war noch eine längst verschilfte und verschlammte Schleuse aus dieser zeit zu sehen. Damals war hier Schiffsverkehr. Nun gab es nur noch wenige kleine Fischerboote hier. Zur Zeit unseres Besuches wurde gerade "Hornfisk", ein recht stachelig aussehender Fisch gefangen. Die Fänge wurden im Hafen sortiert. Die aussortierten Fische flogen einfach ins Wasser, wodurch sich der liebliche Duft des Grundschlammes erklärte, den wir im Schiff hatten.
Und Rødbyhavn? Ja, das lag wenige Kilometer weiter östlich. Navigation ist, wenn man . . .
Am nächsten Tag ging es tatkräftig an die Behebung des Schadens. Zunächst musste Material beschafft werden, Bleiblech und Persenning. Dazu musste ich nach Nakskov. Es war eine lustige Fahrt dorthin. Das Auto - ein uralter Ford - wurde mit dem ertrag des nächtlichen Fanges beladen. Viele Kisten Hornfisk wurden auf dem Gepäckträger gestapelt, und als der nicht mehr ausreichte, auf das Dach. Schließlich donnerten wir los. Fischer Rasmussen fuhr ziemlich genau 40 Stundenkilometer, gleichgültig ob die Straße kilometerweit schnurgerade durch die grünen Felder, Wiesen und Weiden Lollands oder durch alte, winkelige aber blitzsaubere Ortschaften ging. Er sang und pfiff die ganze Zeit und erzählte mir ausführlich lange Geschichten, von denen ich kein Ort verstand.
Bald erreichten wir Nakskov, eine gemütliche, typisch dänische Hafenstadt mit modernen Getreidespeichern, Lager- und Umschlageinrichtungen. Wir fuhren zu einer Fischverwertungsanlage. Die Fische wurden begutachtet und abgeladen. Dann kam ich dran und unsere ganze Havarie wurde in epischer Breite mit anderen Fischern erörtert. Mir war etwas unbehaglich bei den bedächtigen Meinungsäußerungen und prüfenden Blicken dieser Fachleute. Ich verstand nicht viel, konnte aber immer wieder feststellen, dass niemand den Kopf schüttelte oder mich auslachte. Zum Schluss bekam ich einen schönen fetten Räucheraal.
Wir gingen nun in verschiedene Geschäfte und kauften, was wir brauchten. Da heißt, mit dem einfachen Wort "kaufen" lässt sich unsere Unternehmung nicht ganz beschreiben. Fischer Rasmussen war überall bekannt, und so machten wir bei fünf einschlägigen Geschäften regelrechte Besuche. Erst wurde ich vorgeführt, dann bedächtig unsere Geschichte erzählt, die mit ebenso bedächtigem Kopfnicken angehört wurde. Erst zum Schluss wurden auch unsere Wünsche geäußert. Wir mussten feststellen, dass zumindest das Bleiblech nicht ganz leicht zu bekommen war. Aber schließlich hatten wir auch das und fuhren zurück nach Kramnitze.
Winfried und Helmut hatten inzwischen unsere Ausrüstung und Verpflegung gesichtet. Wieder einmal hatte der Schaden schlimmer ausgesehen, als es war. Außer dem Waschpulver waren nur einige Pakete Nudeln und Haferflocken verdorben. Die beim harten Krängen des Bootes beim Einschleppen von deck gefallenen Gegenstände: Treibanker, Reserveanker mit Trosse, Bootshaken und den geslippten Hauptanker hatte Winfried tauchend aus der duftenden Brühe gefischt. Der wesentlichste Verlust war die vollständige Auflösung des Nachtrages zum Seehandbuch 1942 der mittleren Ostsee, der uns späte noch oft fehlte.
Die Fischer ließen es sich nicht nehmen, unser Leck fachmännisch zu dichten.

Zunächst wurde ein mit Teer getränktes Stück Persenning über das Loch gelegt. darüber das Bleiblech glatt an die Rundung des Bootskörpers gehämmert und mit Kupfernägeln festgenagelt.
Anschließend wurde das Boot wieder zu Wasser gebracht. Wir waren sehr gespannt, wie sich das Leck verhalten würde. Es zeigte sich, dass gute Arbeit geleistet worden war, es drang kein bisschen Wasser ein.
Am nächsten Tage, Dienstag, dem 1.6.1954, wurde VAGANT völlig leer bei spiegelglatter See ohne große Schwierigkeiten aus dem Hafen geschleppt. Draußen ankerten wir und übernahmen unsere gesamten Sachen vom Motorboot. Es gab noch eine Menge Arbeit, bis alles wieder seefest an seinem Platz lag. Das Schwert machte uns den größten Kummer. Es war verbogen und durch die Gewalt des auf Grund stoßenden Bootes weit in den Schwertkasten gedrückt worden. Nachdem wir oben den Deckel abgeschraubt und das Ausbringen mit Bordmitteln vergeblich versucht hatten, tauchte ich unter das Boot und besah mir den Schaden. Es war nichts zu machen, nur rohe Gewalt konnte helfen. Wieder halfen uns die Fischer. Es tat mir in der Seele weh, mit einem schweren Hammer ein dickes Brecheisen in den Schwertkasten treiben zu müssen. Aber es musste sein. Ganz langsam gab das bockige Stück Blech nach. Aber schließlich war auch das überstandenen und nach herzlichem Abschied von den biederen Fischersleuten segelten wir los.
Nach kurzer Fahrt erreichten wir das richtige Rødbyhavn. Wir hofften, hier das Boot mit einem Kran hochnehmen und das Schwert richten zu können. leider gab es keinen Kran. So bekamen wir einen richtigen schönen Ruhetag mit Sonnenschein, Schwimmen und Besuch meiner Meerjungfrau von Kramnitze. Sie war mit ihrem Knallert 30 km weit vom Hof ihres Vaters hierher gekommen.
Als Abschied von Dänemark besuchten wir am nächsten Morgen die nahe gelegene Stadt Rødby.
Am Nachmittag segelten wir weiter, diesmal mit dem festen Entschluss, bis Schweden durchzuhalten. Mit wechselnden Windrichtungen und -stärken kreuzten wir ständig gegen an. Am Abend des 3. Juni hatten wir Moens-Klint, die berühmten Kreidefelsen erreicht. Es briste derart stark auf, dass wir uns entschlossen, den Hafen Klintholm anzulaufen. Mit brausender Fahrt jagten wir raumschoots an brechender See entlang auf das Land zu. Der Spinnakerbaum ging über Bord - ade, der Versuch, ihn aufzufischen wäre hoffnungslos. Unter Land wurde die See ruhiger, dafür aber der Wind, beeinflusst durch die hohe Insel um so bockiger. Mit Brassfahrt brauten wir in den Hafen, der schon voller Fischkutter lag, die vor dem Wetter Schutz suchten. Es war sehr eng. Viel zu eng für unsere hohe Fahrt. Aber irgendwie brachten wir einen eleganten Aufschießer zustande und lagen bald sicher vertäut neben einem Kutter, während der Wind mit 7 Beaufort in den Masten und Wanten heulte.
Am Kai empfing uns der sehr sympathische Zollinspektor Hansen. Er war traurig, dass alle deutschen Segler, die Klintholm besuchen, es nur als Zwischenstation auf dem Weg nach Schweden benutzen. Er zeigte mir einen Schriftwechsel mit einem Hamburger Großkaufmann, der schon mehrere Jahre nacheinander seinen Urlaub mit Familie dort verbrachte. Und wirklich, er hatte recht. Die dunklen Wälder auf den Hügeln hinter den steil abfallenden eindrucksvollen Kreidefelsen sind dem Sauerland ähnlich. Und doch ganz anders. Man spürte überall das Meer.
In unserem Drang in die ferne verbrachten wir nur einen Tag auf dieser Insel, an deren erholsame Ruhe ich noch heute oft zurückdenken muss und legten schon am nächsten Abend wieder ab..
Das Seehandbuch warnte: flache Küste, Sandbänke. Wir steuerten vorsichtig genau die Fahrrinne der
Bei leichten Winden - zumeist gegen an - segelten wir durch eine herrliche Sternen funkelnde Nacht. Der Widerschein der Sonne wanderte im Norden über den Horizont, bis sie selbst in voller Pracht im Osten wieder aus dem Meer stieg.
An der Kimm vor uns erschien undeutlich ein flimmernder Strich: Schweden. In gemütlicher Faulenzerfahrt kamen wir näher. Der Strich begann, Formen anzunehmen. Verschwommene Bilder großer Häuser, Bäume und Kirchen flimmerten im grellen Sonnenlicht. Schließlich eine besondere Anhäufung von Gebäuden, einige große Getreidesilos, Kräne. Das musste Trelleborg sein, der bekannte Fährhafen. Das Seehandbuch warnte: flache Küste, Sandbänke. Wir steuerten vorsichtig genau die Fahrrinne der großen Eisenbahnfähre an, die wie eine Chaussee weit draußen begann. Backbord und Steuerbord große Tonnen, schön in Reih und Glied wie zuhause die Straßenbäume. In dem glasklaren Wasser war der Grund zu sehen. Sauber und ordentlich sah die Straße dort unten aus. In der Mitte heller Sand, wie gefegt; an beiden Seiten Tangbüsche der Fahrwassertonnen. Bald waren wir im Hafen, der in seiner Vielfalt ein etwas verwirrendes Bild bot. Wir sahen mehrere Becken und wussten zunächst nicht recht, wohin wir uns wenden sollten. Steuerbord voraus lag eine große saubere Mole, geschmückt mit den Flaggen vieler Nationen. Ein Jachtliegplatz war nirgends zu erkennen. Nur in einem Nebenbecken lag neben riesigen Kohlenbergen ein einzelner Segler. Die Ecke schien uns zu schmuddelig. Also gingen wir erst einmal an der beflaggten Mole längsseits.


Zum ersten Mal in diesem Jahr betraten wir schwedischen Boden. Es war Wochenende und dazu noch Pfingsten, so dass sich kein Zoll- oder Passbeamter um uns kümmerte. Alles war "stängt", geschlossen. Kaum ein Mensch zu sehen. Ganz Trelleborg lag auf den benachbarten Badestränden. Als wir dorthin kamen, waren wir überwältigt. Auf einer unübersehbaren Strecke von vielen Kilometern lagen hier Tausende von Menschen in der Sonne.
Angesteckt von dieser Massen-Stadtflucht beschlossen wir, die nächsten Tage hier zu verbringen. Wir segelten also am nächsten Morgen bei flauen Winden ein Stück an der Küste entlang nach Osten und ankerten, wo uns die nettesten Mädchen am dichtesten zu liegen schienen. Das Schlauchboot wurde aufgepumpt, wir pullten an Land und mischten uns unter´s Volk. Es tat gut, mal wieder so richtig faul in der Sonne zu liegen.
Einige Stunde vergingen. Die Mägen begannen zu knurren und wir gingen wieder an Bord, um Mittag zu essen. Hier hatten wir inzwischen besuch bekommen. Ein netter kleiner Junge, etwa 10 Jahre alt, war herübergeschwommen und wollte unbedingt bei uns bleiben. Er krabbelte überall herum, befühlte alles und erzählte munter drauflos, ohne dass wir viel verstehen konnten.
Während wir aßen, begann es, unruhiger zu werden. Etwas Wind und Seegang kamen auf. Unser Ankerplatz war in keiner Weise geschützt, so dass wir uns entschlossen, wegzusegeln. Wir liefen in den nächsten Fischerhafen - Gislövs Läge - an und legten uns wieder an den Strand in die Sonne. Unser kleiner Freund wollte unbedingt an Bord bleiben. Er war überglücklich, als wir es ihm erlaubten und ihm sogar noch das Schlauchboot zum Herumpaddeln überließen.
Ohne dass wir es ahnten, hatte sich inzwischen über uns ein amtliches Gewitter zusammengezogen. Als wir so friedlich dalagen, erschien urplötzlich ein sehr böse dreinblickender Herr. Offensichtlich passte es ihm nicht, dass er ausgerechnet am Pfingstsonntag am Badestrand in Aktion treten musste. Vielleicht kam er sich auch gerade deshalb so wichtig vor. Er forderte uns mit scharfen Worten auf, sofort mit unserem Boot den Hafen zu verlassen und zurück nach Trelleborg zu segeln. Es sei nicht gestattet, dass Ausländer einen Hafen anlaufen, der keinen Zollhafen besitzt. Das war nach meinen Erfahrungen von 1952 nicht neu. Damals hatten wir den Hafen Skanör auf Falsterbo angelaufen und wurden aus dem gleichen Grund rausgeschmissen. Ich hatte mich deshalb später mit der schwedischen Gesandtschaft in Deutschland in Verbindung gesetzt. Dort sagte man mir, dass diese Vorschrift zwar für ganz Schweden gelte, aber nur im Süden so scharf gehandhabt würde. Sie wunderten sich selbst darüber. Ich sollte doch einfach weiter nach Norden segeln, da täte uns niemand etwas. Wie dem auch sei, es hatte keinen Zweck, sich jetzt mit dem Beamten herumzuzanken. Wir segelten nach Trelleborg zurück. Unterwegs brachten wir unseren kleine Freund an Land, der mir beim Abschied mit der vollendeten Grandezza eines großen Herrn eine Flasche Sprudel und eine Tüte Bonbons überreichte. Einfach niedlich. -
Im Hafen von Trelleborg wurden wir diesmal trotz des Sonntages erwartet. Wir waren etwas erbost über den gestörten Sonntag, und da wir gerade mit gutem Wind am Segeln waren, beschlossen wir, uns etwas zu rächen. Wir liefen auf den Beamten an der Mole zu. Als er schon meinte, dass wir jetzt anlegen würden, drehten wir scharf ab und liefen auf die gegenüberliegende Pier zu. Dort schossen wir in den Wind und warteten, bis er mit seinem Fahrrad das beträchtliche Stück Weg um das große Hafenbassin gefahren war. Als er uns fast erreicht hatte, nahmen wir wieder Fahrt auf und segelten in das nächste Hafenbecken. Dieses verruchte Spiel mit der Sicherheit Schwedens setzten wir fort, bis wir einmal den ganzen Hafen abgesegelt hatten. Dann legten wir uns in einen abgelegenen Winkel an irgendeinem Steg. Unser Polizist hatte sich inzwischen Verstärkung geholt. Beide kamen nach ihrer langen Radtour etwas außer Atem bei uns an und begannen auf schwedisch sehr amtlich mit uns zu reden. Wir lächelten und verstanden vorsichtshalber nichts. Bis der Eine mit einem Dolmetscher zurück war, hatte sich der andere schon wieder etwas beruhigt. Wir fragten ganz unschuldig, ob es denn verboten sei, in diesem Hafen ein wenig zu segeln. Nun, dagegen hatte man nichts, jedoch wurde uns sehr dienstlich erklärt, dass sich der Kapitän am Dienstag auf der Kriminalpolizei zu melden habe.
Da wir sowieso hier bleiben wollten, fuhren wir am Pfingstmontag mit dem Bus an den Strand. Für uns, die wir unser Antlitz verhüllten, wenn ein nettes Mädchen vorbeikam, gab es hier schon allerhand zu sehen. Man soll mit Superlativen sehr vorsichtig sein, ich glaube aber doch wohl sagen zu können, dass es gerade in Schweden einen höheren Prozentsatz Gutaussehender Menschen gibt als bei uns. Ein schwedischer Freund mit bemerkenswert wenigen nationalen Vorurteilen und beachtlicher einschlägiger Erfahrung bestätigte mir das später. Er sagte aber auch gleich dazu, dass es dafür aber auch einen wesentlich höheren Anteil als in vielen anderen Ländern an solchen Menschen gebe, die zwar bestechend aussehen und alles für ihr äußere Erscheinung tun, im Übrigen aber hohle Nüsse seien. Wir hatten auch gleich Gelegenheit, das festzustellen.
Da wir uns einmal alle Drei auf eine Bild sehen wollten, bat ich ein paar nette Mädchen neben uns in wohl vorbereitetem Schwedisch, uns mit unserem Apparat zu Fotografieren. Ich glaubte, diese Bitte wohl ändern zu dürfen, da sie uns vorher schon mehrfach auf´s Korn genommen hatten. Als ich dann aber vor ihnen stand und meine rede redete, sahen sie eiskalt durch mich hindurch und gaben nicht mal eine Antwort. Das wäre nicht der Rede wert gewesen, wenn es nur einmal passiert wäre; es war nur erstaunlich, dass wir auch später als einzige Antwort auf eine harmlose Frage nach dem Weg oder dergleichen oft nur diesen "schwedischen Blick" - wie wir da später tauften - erhielten. Eine Schwedin erklärte mir viel später, dass diese Art der Ablehnung leider oft die einzige Möglichkeit sei, sich die mitunter merkwürdigen Annäherungsversuche schwedischer Männer vom Leibe zu halten.
Ich wandte mich nach diesem Abblitzen an einen einzelnen Herrn, der gleich daneben lag. Als er meine drei Worte Schwedisch hörte, begann er zu reden wie ein Buch. Er schien alles übers Fotografieren zu wissen und machte diesen Meisterschnappschuss von uns:
(Bild liegt leider nicht vor)
Am Dienstag ging ich gleich morgens zur Polizei. Wie es wohl oft bei diesen amtlichen Einrichtungen ist, war der höhere Beamte wesentlich freundlicher- Er wies mich nur auf die bereits erwähnte Bestimmung hin und erklärte mir, wie die ganze Angelegenheit von Seiten der Polizei aussah. Danach hatten wir verbotswidrig vor der Küste geankert und noch verbotswidriger mit einem Boot Verbindung mit dem Land aufgenommen, um vermutlich Alkohol zu schmuggeln. Als wir dann die Polizei kommen sahen, flüchteten wir schnell in den nächsten Hafen, weil wir wussten, dass dort keine ständige Zollaufsicht war, um dort unserer dunklen Geschäfte fortzuführen. Im Hafen von Trelleborg schließlich versuchten wir, die Beamten irrezuführen.
Ich konnte im vor Lachen kaum antworten. Er zog es vor, meine Erklärungen zu glauben und lachte mit. Nunmehr stand unserem ordnungsgemäßen Einklarieren nichts mehr im Wege. Wir bekamen unseren Zollpass, der uns zum Anlaufen weiterer schwedischer Häfen ohne Zollabfertigung berechtigte; und wechselten etwas Geld.
Mittags klarierten wir aus und segelten nach Osten weiter an der schwedischen Südküste entlang. Abends erreichten wir Sandhammeren und damit den Anfang der nordischen Miniatur-Biskaya", der Hanö-Bucht. Nach all´den Schilderungen dieses Gewässers hatten wir einigen Respekt vor dem Stück, das jetzt vor uns lag. Bei Windrichtung aus Südwest über Süd bis Ost hat man in Luv sehr viel offenes Wasser mit entsprechendem Seegang, in Lee eine gefährliche Schärenküste mit nur wenigen Häfen, für die man außerdem noch Spezialkarten benötigt, die wir natürlich nicht hatten.
Es kam aber ganz anders. Der Wind flaute ab und schralte, so dass wir schließlich hoch anliegen mussten. Es kam eine wundervolle Nacht. VAGANT lief mit leise gluckernder Bugwelle wie träumend vor sich hin. Über uns die funkelnden Sterne, im Norden ein goldener Schein von der Sonne hinter der Kimm. Auf der ersten Stück des Weges war - ganz undeutlich - ein Leuchtfeuer der Insel Bornholm zu auszumachen. Es flimmerte als winziges Pünktchen einige Male am Horizont, um bald ganz zu verschwinden. Wir waren ganz allein mit der langen, von Süden heranrollenden Dünung, die uns hob und senkte wie die atemberaubende Brust eines schlafenden Riesen. -
Die Nacht verging und gegen Mittag kam wieder Land in Sicht. Diesmal keine gastliche Küste, sondern die kahlen Felsen einiger Schären mit einem Leuchtturm, weit vor bewohntem Land. Hier gab es kein Eckenschrammen. Wir hielten uns im Gegenteil soweit wie möglich von den wenig einladenden Felsen fern.
Bald versanken sie achteraus und vor uns lag Öland, die lang gestreckte Insel der Windmühlen.
Wir hatten die Absicht, zwischen Insel und Festland nach Norden den Kalmar-Sund zu durchfahren. Als erste Station war Kalmar vorgesehen. Am Nachmittag legte Rasmus aber einen derartigen Zahn zu, dass wir froh waren, nach hartem Segeln abends den Zementhafen von Degerhamn auf Öland zu erreichen.
Mir Brassfahrt brausten wir in den weiten Hafen. Große Zementsilos, lange Kaimauern. Einen Hafenplan hatten wir nicht. Wir folgten einfach den auch im Hafen ausgelegten Seezeichen und segelten auf eine der mächtigen Molen zu, um uns dort hinzulegen.
Plötzlich einige harte Stöße - ein Ruck und wir saßen mal wieder fest. Ratlos sah ich zu der in unmittelbarer Nähe liegenden Spierentonne hinüber. Wir hatten sie auf der gleichen Seite passiert wie die Übrigen. Trotzdem saßen wir auf einem riesigen Stein fest, der höchstens einen Meter unter der Wasseroberfläche lag. Der Wind war stark genug, um VAGANT durch starkes Krängen unter Vollzeug wieder Freisegeln zu können. Mit unbehaglichem Gefühl glitten wir über die bemoosten Köpfe weiterer Steine. Es bumste noch ein paar mal, bis die Fahrrinne wieder erreicht war.
Später erfuhr ich auch den Grund des Malheurs: die schwedischen Seezeichen bezeichnen nicht immer die gleiche Seite des Fahrwassers. Es kommt vielmehr darauf an, in welcher Kompassrichtung es verläuft. So kann es vorkommen (wie es auch hier war), dass nach einem scharfen Knick die Zeichen plötzlich an der anderen Seite zu lassen sind.
Tja, so was muss man eben wissen.
Solche Grundberührungen waren - abgesehen von der Gefahr, das Schwert zu verbiegen - nicht weiter tragisch. Die Steine sind fast immer rund, glitschig und ohne Spitzen. Da nun eigentlich nur der harte Eisenkiel mit ihnen zusammengeriet, konnte nicht viel passieren.
Nach einer gründlich durchschlafenen Nacht begrüßte uns am nächsten Morgen - ein Berliner. Das heißt, das war er mal. Als Ingenieur beim Aufbau der Zementwerke eingesetzt, hatte er nach jahrelanger Arbeit in Schweden bei jedem Besuch zuhause Schwierigkeiten mit Hitlers Finanzbehörden. So wurde er schließlich Schwede.
Er erzählte uns, dass im Kriege viele internierte deutsche Soldaten hier gearbeitet hatten. Nur wenige, meistens Deserteure, hätten Schwierigkeiten gemacht. Einige gute Arbeiter seien nach dem Krieg wieder hierher gekommen. Im Übrigen hätten sie schon während des Krieges den Bevölkerungsstand merklich angehoben.
Wir mussten weiter. nach einem kurzen Besuch beim Hafenmeister und seiner ungewöhnlich hübschen Tochter kauften wir im Laden erst einmal eine Spezialkarte der engsten Stellen des Kalmar-Sundes. Dort, unmittelbar vor den Toren Kalmars ist die Fahrrinne so eng, dass es nicht zu empfehlen ist, die Durchfahrt auf gut Glück zu versuchen.
Wir erreichten Kalmar nach kurzer Fahrt noch am gleichen Nachmittag. Das berühmte alte Schloss grüßte schon von Weitem. Von See aus bietet es einen imposanten Anblick.
Imposant aber gemütlich ging es auch im Hafen zu.
Kalmar ist ein bedeutender Holzumschlaghafen. Außerdem fährt alle halbe Stunde eine Fähre nach Öland oder kommt von dort. Als Segler kamen wir uns ziemlich überflüssig in dem Getriebe vor. Wir mussten jedenfalls während unseres Aufenthaltes mehrmals den Platz wechseln, weil neue Schiffe kamen.
Wir blieben 2 Tage, um Stadt und Schloss zu besichtigen. Die Stadt erstreckt sich über mehrere Inseln. Sie ist eine der ältesten Städte Schwedens und war jahrhundertelang Königssitz. Reste der Stadtumwallung und viele alte Bauten sind noch heute Zeugen ihrer Vergangenheit. Auch das Schloss liegt auf der Insel. Seine hohen, kanonenbestückten Wälle und die grauen Mauern mit ihren Schießscharten wirken düster und drohend. Innen ist es heute als Museum eingerichtet. Wir stöberten ausgiebig darin herum, wobei uns natürlich besonders die Abteilung Seefahrt interessierte. Hier gab es alte Modelle und Bilder der Schiffe früherer Zeiten, darunter uralte Kompasse, Sextanten, Chronometer, Loggs, Peilgeräte und Seekarten, die Urgroßvater all´ der Dinge die für jede Seefahrt notwendig sind und ohne die auch wir nicht hier wären.
Im Hafen hatten wir Gelegenheit, einige der letzten Frachtsegler zu sehen, die noch heute ihre Fahrten in der Hauptsache unter Segeln machen. Es waren Galioten, die noch in fast allen Einzelheiten alte seemännische Tradition zeigten. Zwei bis drei Masten, riesige Klüverbäume mit Wasserstag und Netz, Wanten mit Jungfern, große Teakholz-Steuerräder mit funkelnden Messingbeschlägen. Im weiteren Verlauf unserer Reise sahen wir auch einige von ihnen unter Segeln.
Beim Auslaufen am Sonnabend, dem 1. Juni waren wir wieder einmal fest entschlossen, jetzt aber bestimmt durchzusegeln. Diesmal bis Stockholm.
Die Türme des Schlosses versanken in der Ferne. Mit frischen günstigen Winden aus Südost brachten wir die Enge des Kalmar-Sundes bald hinter uns und passierten die düstere Ruine des Schlosses Borgholm.

Die "blaue Jungfrau" im Hintergrund (2)
Vor uns begann, noch fern und unwirklich "Bla Jungfrun", die "Blaue Jungfrau" über die Kimm zu steigen. Wie die Brust einer Jungfrau, daher der Name, sagen die Schweden. Infolge ihrer Höhe von etwa 80 Metern war die ebenmäßig gerundete Insel schon auf große Entfernung zu erkennen.
Nachdem wir alle Warnungen und Verbote des Seehandbuches gelesen hatten, gab es für uns nur eins: landen. Wir kamen näher an den riesigen Steinklotz heran und sahen, dass er gar nicht blau war, wie er aus der Ferne im Dunst schimmerte, sondern rot.
Vorsichtig loteten wir uns in Lee heran und fanden an der Nordostseite die einzige, nach zwei Seiten geschützte Bucht. Wir schoben VAGANT in eine Felsspalte und gingen daran, das herrliche Stückchen Land zu erforschen. Überriesige, von Urzeitgletschern glatt geschliffene Felsplatten, vorbei an windzerzausten Kiefern, auf dichten, bunten Moosteppichen erreichten wir den Gipfel. Von hier aus sahen wir im Westen das Festland, im Osten die Insel Öland und im Norden die riesige Weite des Meeres. Über uns schwebten segelnd die Bewohner der Insel, eine besondere, riesengroße Art Raubmöven. Ihr Schrei klang wie der der Wildgänse.
Beim Abstieg nach der anderen Seite stießen wir auf eine merkwürdige, künstlich angelegte Ansammlung - das "Labyrint". Was es bedeutet und wer es angelegt hat, weiß ich noch heute nicht.
Wir streiften weiter durch urwalsähnliches Gestrüpp und kamen wieder zum Ufer. Blanke rote Granitplatten mit Spalten, die durch den Anprall der Wellen von Jahrtausenden zu ungewöhnlichen Formen ausgewaschen waren, einzelne angefüllt mit bunten, sauber rundgeschliffenen Steinen. An der Luvseite der Insel das ständige Donnern der Brandung, hoch aufspritzende Gischt und das faszinierende Bild der in ewigem Gleichmaß heranrollenden Wellen. Wir kletterten am Ufer entlang. Ein wilder Weg. An der Ostseite auf einem Stein eine mit Ölfarbe aufgemalte Inschrift, die eine Schiffstragödie ahnen ließ.
Wir blieben eine Nacht. Am nächsten Morgen erwachte ich gegen halb fünf. Die Sonne war schon aufgegangen und draußen wehte ein frischer Südwind. Meine Crew lag noch fest in den Kojen, als ich ganz sacht und leise ablegte. Erst das laute Knattern der beim Setzen killenden Segel und der beginnende Seegang machte sie munter. VAGANT nahm Fahrt auf. Der Spinnaker wurde gesetzt und bald war jede Spur von Land hinter uns verschwunden.
Unser Kurs führte uns nun über offene See. Es war ein prachtvolles Segeln. Der Wind frischte auf, ohne jedoch unangenehm hart oder gar gefährlich zu werden. Immerhin gierte aber das Boot in der hohen, von achtern auflaufenden See derart, dass der Rudergänger sehr aufmerksam steuern musste. Trotzdem war es nicht zu vermeiden, dass VAGANT durch eine besonders hohe See quer schlug und das Großsegel in einer Patenthalse überging. Es gab ein paar spannende Sekunden, denn wir hatten zur zusätzlichen Sicherung des Mastes einen Preventer angeschlagen. Durch ihn wurde das Großsegel gehindert, frei auszuwehen. VAGANT legte sich unter dem Winddruck und der nächsten See so hart über, dass Wasser ins Cockpit lief. In diesem Augenblick wurde der Preventer gekappt, das Großsegel rauschte aus, und die See war unter uns durch. Das Boot richtete sich nunmehr derartig ruckartig auf, dass fast ein Mann außenbords gegangen wäre. Er konnte sich gerade noch halten, nur seine Mütze war weg. Also doch: "Mann über Bord!" Ehe wir den Spinnaker geborgen hatten, waren wir schon ein gutes Stück davon gerauscht. Die Mütze zeigte sich hin und wieder auf den Wellenkämmen. Wir kreuzten zurück und hatten sie bald erreicht. Aber die Bergung klappte nicht. Wenn wir - genau nach der "Seemannschaft" in Lee der Mütze aufschossen, tanzte sie uns zwar unmittelbar vor dem Bug herum, jedoch ohne sich greifen zu lassen. Wir segelten einige scharfe Kreise, um ruhiges Wasser zu schaffen. Das gelang wohl, aber ehe wir nach dem scharfen Wenden und Halsen genügend Fahrt aufgenommen hatten, um erneut an das in dem kleinen Fleck toter Dünung friedlich schaukelnde gute Stück herankommen zu können, kam der nächste Brecher, der alles zu Nichte machte. Die Mütze war weg, und wir gingen etwas nachdenklich wieder auf Nordkurs.
Waren wir genügend ausgerüstet und darauf vorbereitet, wenn einmal nicht nur eine Mütze, sondern auch der dazugehörende Mann in den großen Bach ging?
Weiter ging die brausende Fahrt. Ich lag in der Koje.
"Wind schralt, Spinnakerbaum weg!" hörte ich im Halbschlaf den Rudergänger rufen. Die Fock ging über, die Bewegungen des Bootes wurden härter. "Wind schralt weiter, ich kann den Kurs nicht mehr halten!" hörte ich nach einer Weile wieder den Rudergänger. Also raus. Oben angekommen schaute ich mich erstaunt um. VAGANT lag hoch am Wind, hart kreuzend. Der Kurs stimmte. Aber was war denn das, die Sonne stand weit im Westen, und es war doch erst Nachmittag? Schnell den Standort nachgerechnet. Siehe da, dieser abstrakte, sich aus Ausgangsposition, Zeit, Geschwindigkeit und Kurs ergebender Punkt lag auf einer umrandeten Stelle der Karte mit der lakonischen Bemerkung: "Magnetiks störningsomrade", Gebiet magnetischer Störungen. Das waren ja schöne Aussichten. Es blieb uns nichts anderes übrig, als nach alter Väter Sitte nach Sonne und Wind zu segeln. Der Kurs wurde nach der berühmten Pfadfindermethode mit der Uhr ermittelt: Man peile die Sonne über die Mitte zwischen dem kleinen Zeiger und der Zwölf. Der Zeiger weist dann genau nach Süden. So segelten wir eine ganze Weile erst mal gegen den kleinen Zeiger, bis sich unsere Kompasse wieder beruhigt hatten.
Beim nächsten Landfall war äußerste Vorsicht geboten. Bald war es soweit. gegen Abend erreichten wir einen Standort südlich des bedeutenden Leuchtturms Landsort auf Öja. Jedenfalls musste er nach meiner Rechnung bald auftauchen; zu sehen war noch nichts. Da trat das ein, was wir nach Lage der Dinge wohl am Wenigsten gebrauchen konnten: der Wind schlief vollständig ein. In der langen, toten Dünung legte sich das Boot quer. Die Segel schlugen bei dem wahnsinnigen Dümpel knallend hin und her. Wir mussten sie bergen, damit nichts brach. Wir versuchten zu schlafen, fanden aber keinen Halt in den Kojen. Der Versuch, etwas Warmes zu kochen, endete mit einem heillosen Durcheinander. Zu allem Überfluss begann es auch noch zu regnen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als dumpf brütend in irgendeiner Ecke festgeklemmt finster Pläne zu wälzen: Schiff verkaufen, Geld gut anlegen, reisen von den Zinsen mit der Bahn machen und was dergleichen Unsinn mehr ist. Es war einer der tiefsten Tiefpunkte der ganzen Reise. -
Nach Stunden erst regte sich das erste Lüftchen. Ausgerechnet aus Nordost, der Richtung, in die wir segeln wollten. Mit der hohen Dünung von achtern und dem im schwachen Wind bei den heftigen Bewegungen kaum voll zu haltenden Segeln machte das Kreuzen keine Freude. Das Schwert klemmte mal wieder, so dass der Rudergänger ständig hart Ruder legen musste, um das Boot richtig am Wind zu halten. Es dunkelt. Vor uns blitzte, deutlich und nicht zu verkennende Leuchtfeuer Landsort.
Das bedeutete für uns jetzt viel, denn um im Dunkeln in die uns noch völlig unbekannten Schären zu kreuzen, brauchten wir einen genauen Standort.
Gegen Mitternacht passierten wir die Landsort-Ansteuerungstonne. Um ganz sicher zu gehen, wollten wir ganz dicht an den Leuchtturm heran. Wir kreuzten weiter.
Es war unheimlich. Die Nacht war so finster wie selten. Der Leuchtturm schickte seine Blitze und Blinke in regelmäßigen Zwischenräumen. Er schien sehr hoch zu stehen. Der Abstand war nicht zu schätzen. Also noch näher ran. Unter den weißen Signalen hoch oben tauchte ganz unten ein rotes Licht auf. Der Warnsektor eines kleinen Leitfeuers. Wir segelten noch näher heran. Das wechselnde Blinken des strahlend weißen Lichtes oben und des kleinen, trüben, gefährlichen roten unten, begann uns auf die nerven zu gehen. In der Nähe lauerten gefährliche Klippen. Noch eine Stunde mussten wir aushalten, dann waren wir so nahe heran, wie es nur möglich war. Nun hatten wir wieder einen genauen Standort und begannen, in den "Stockholm Skärgard" einzukreuzen . . .
Eine völlig neue, unbekannte Welt empfing uns. Wohin wir in der beginnenden Dämmerung sahen, lagen Inseln. Große und kleine, niedrige und hohe. Einige reichten gerade über die Wasseroberfläche, überwaschen von der Brandung wie der Rücken riesiger Wale, andere schienen turmhoch wie kleine Gebirge. Viele waren bewachsen, andere kahl. Der Wind nahm zu, und es begann zu regnen. Das Boot ließ sich schlecht steuern. Durch das zu hoch stehende Schwert war es stark luvgierig und nicht kursstabil.
Wir kreuzten weiter im Hauptfahrwasser gegen an. Jedes Eckenschrammen, jede Ausdehnung eines Kreuzschlages über den Hauptweg hinaus schien gefährlich. Überall warnte die Karte vor Klippen und Steinen in der Wasserlinie. Unmittelbar daneben Wassertiefen von 40 bis 50 Metern.
Es regnete weiter. Der Wind nahm weiter zu, graue Wolkenfetzen jagten über die düstere Landschaft. Wir besannen uns darauf, dass im Achterpik noch unser Motor lag und versuchten, ihn in Gang zu bringen. Wir bemühten uns eineinhalb Stunden, dann gaben wir es auf. Er wollte einfach nicht. Ein Motor für Segler, denn schließlich wehte es ja noch ganz nett. Also kreuzten wir weiter.
Gegen Mittag erreichten wir die idyllisch aber enge Durchfahrt bei Dalarö. Wie fast immer, wenn wir auf dieser Reise Schwierigkeiten hatten, blieb es auch diesmal nicht bei einem Hindernis. Zu dem Wind, gegen den wir mit unserem klemmenden Schwert mühsam aufkreuzten und einer ganz netten Gegenströmung kam ausgerechnet an der engsten Stelle noch ein Schlepper, der ein mehrere hundert Meter langes Floß aus dicken Baumstämmen hinter sich her schleppte. Es war sehr interessant und lehrreich einmal zu sehen, wie dieser riesige Wurm sich langsam um die Ecke wand. Wir gerieten dadurch sehr in Bedrängnis, der wir nur dadurch entgehen konnten, dass wir wieder ein Stück zurück segelten. Mit welchen Gefühlen wir mühsam erkreuzte Höhen preisgaben, lässt sich mit höflichen Worten nicht beschreiben, wenn auch der tatsächliche Verlust nicht viel ausmachte.
Aber auch das ging vorüber. Einige Meilen hinter Dalarö konnten wir auf Nordwestkurs gehen und auf Backbord-Bug wieder einmal raumschoots laufen.
Der Dampferverkehr nahm zu. Viele deutsche Schiffe kamen vorbei, meist moderne, schöne Neubauten.
Leider hielt der schöne Wind nicht durch. Er wurde schwäche rund schwächer. Wir passierten den feudalen Badeort Saltsjöbaden, überquerten den Baggensfjärden und liefen in das enge Fahrwasser nach Duvnäs ein. Hier war es ganz aus. Der Wind stand "auf und nieder". Es war sicher gut, dass wir jetzt etwas Gesellschaft bekamen. Wir holten eine schwedische Jacht ein, die schon von Saltsjöbaden an den gleichen Kurs steuerte. Sie war schlank und sah sehr schnell aus. Umso mehr wunderte es uns, dass wir schneller segelten. Als wir nahe heran waren, erkannten wir den Grund. And er Pinne saß gar kein dicker Mann, wie es aussah, sondern ein blonder Junge und ein bildhübsches Mädchen, die sich sehr eingehend miteinander beschäftigten. Wenn man die beiden sah, musste man sich wundern, dass das Schiff überhaupt noch Kurs steuerte. nach den üblichen Fragen nach dem Woher und Wohin übernahmen die Schweden sofort die Sorge für unsere Fortbewegung. Sie waren zu dritt an Bord, ihr Bruder lag diskret unter Deck. Eine Flasche Zitroneneislikör machte die Runde, Lena kam als Lotse zu uns an Bord, eine Motorjacht wurde herangewinkt und innerhalb einer Viertelstunde lag VAGANT im Liegeplatz von Saltsjö-Duvnäs.
Als wir nach einer gründlich durchschlafenen Nacht wieder aufwachten, hatten wir schon netten Besuch. Lena stand da und lud uns zu ihren Eltern ein. Wir trauten uns in unserem unrasierten Zustand nicht so recht, folgten aber schließlich doch recht gern der Einladung, uns wieder einmal richtig zivil zu waschen und zu rasieren. Wir wurden sehr nett aufgenommen und wussten gar nicht, wie wir uns revanchieren sollten. Nach dem ausgiebigen Frühstück - endlich mal wieder nicht aus Dosen und Tüten - berieten wir, was weiter geschehen sollte. Claes Tjulander, Lenas Bruder riet uns, das Boot hier zu lassen und mit dem Bus nach Stockholm zu fahren. Wir zogen es aber doch vor, ganz dort zu liegen. So segelten wir dann mit Claes an Bord bei günstigem Wind durch das tief eingeschnittene enge Fahrwasser in den Stockholmer Hafen. Es war nicht so leicht, hier einen ruhigen Liegplatz zu finden. Wir entschieden uns schließlich für den "Kungl. Motorbatsklubben" im Djurgardsbrunnsviken. Um dorthin zu gelangen mussten wir mit gelegtem Mast unter einer Brücke durch. Das Manöver gelang zur Verblüffung des skeptischen Klubbootsmannes in so kurzer Zeit, dass er einen ganz und gar unschwedischen Laufschritt einlegen musste, damit er uns noch rechtzeitig am zugewiesenen Liegeplatz in Empfang nehmen konnte. Damit war der erste Teil der Reise beendet.
Leider war inzwischen unsere Zeit so knapp geworden, dass uns nur wenige Tage blieben, um uns umzusehen.
Wir können deshalb nicht sagen, dass wir die Stadt nun kennen, aber etwas wissen wir doch schon Bescheid.
Stockholm ist nichts für Abergläubische, es steht auf 13 Inseln im Schnittpunkt von See- und Schärenküste. Aber es steht fest, schon über 700 Jahre.
Natürlich besichtigten wir möglichst alles, was man gesehen haben "muss": Schloss, Rathaus, Kirchen, Skansen und Tivoli. Wir bummelten durch die Innenstadt, über viele Brücken und an den Kais des Hafens entlang.
Die Schweden haben als seeverbundenes Volk viel für den Segelsport übrig. Auf einigen öffentlichen Plätzen sahen wir Segel- und Motorboote zur öffentlichen Verlosung ausgestellt.
Wir bemühten uns, das Typische zu erfassen, durch das sich Stockholm, wie jede große Stadt, von allen anderen Städten unterscheidet. Solche Beobachtungen sind natürlich subjektiv gefärbt und nicht frei von gewiss unverzeihlichen Verallgemeinerungen.
Nun, uns erschien die Atmosphäre dieser Stadt etwas kühl und müde. Abgesehen von dem turbulenten Linksverkehr, der sich stellenweise in nicht erwartetet Hast und Rücksichtslosigkeit austobte, war man sehr höflich, aber auch förmlich und gleichgültig gegeneinander. Ich glaube, man lacht dort nicht gerne. Ein schwedischer Freund bestätigte mir das. Er meinte, die Schweden im Allgemeinen verständen es nicht gut, lustig zu sein. Wenn sie lachen wollten, müßte man sie kitzeln.
Bezeichnend hierfür erscheint mir auch die Art, wie es auf öffentlichen Tanzveranstaltungen zugeht. Da ist z.B. Skansen, ein Vergnügungspark auf der Insel Djurgarden. Dort, wie auch im Tivoli, sind die Tanzflächen eingezäunt. Eintritt nur für jeweils einen Tanz gegen Eintrittskarten, die an den Einlässen von sehr amtlich aussehenden, polizeiähnlich uniformierten Wärtern kontrolliert werden. Die Damen stehen draußen auf einem freien Platz herum. Je nach Angebot und Nachfrage drängen sich die Herren mehr oder weniger rücksichtslos durch die Menge und suchen sich etwas Passendes für ihre 40 Öre. Wenn "sie" nicht will, ist es schon außerordentlich höflich, wenn sie wenigstens den Kopf schüttelt. Meistens sieht sie einfach nur Luft. "Er" geht dann ohne Umstände zur Nächsten oder Übernächsten. Wesentlich netter und - für meine Begriffe - natürlicher geht es dafür auf einem anderen Tanzplatz in Skansen zu, wo ausschließlich Volkstänze getanzt werden. Es ist erstaunlich, dass sich das "amerikanischste" Volk Europas noch etwas Sinn dafür bewahrt hat.
Man gibt sich hier überhaupt sehr modern. Interessant ist die Anlage der neueren Wohnviertel außerhalb des Stadtkerns. Um einen Kern in normaler Höhe gebauter Geschäftshäuser stehen Reihen großer, moderne Wohn-Hochhäuser. Jeder dieser Türme steht ein gutes Stück von seinem Nachbarn entfernt. Dazwischen liegen Grünanlagen. Diese Häuser sind regelrechte Wohnmaschinen mit allen Schikanen der Zivilisation, bei deren Bau man aber geschickt die Nachteile vermieden hat, die z.B. unseren alten deutschen Mietskasernen anhaften. Jede Wohnung hat ihren Balkon und ist so angeordnet, dass sie in sich ein geschlossenes Ganzes bildet, ohne dass die Bewohner durch Nachbarn gestört werden können. Aus jedem Fenster sieht man wenigstens etwas Grün. Der Blick vom Dach eines solchen Hauses wurde mir zu einem wirklichen Erlebnis. Die Stadt liegt nut wenig südlich der Grenze der Mitternachtssonne. Im Sommer wird es daher kaum richtig dunkel. Die Luft ist wie bei uns im Frühling. Über der Stadt liegt ein geheimnisvoller Schimmer, und in der Höhe ist der Himmel hell. Es ist schwer, in einer solchen Nacht in die Koje zu finden . . .
In einem Arm des Hafens, unweit des königlichen Schlosses liegt eine Anzahl kleiner Fischerboote, die an Auslegern große runde Netze trugen. Was die wohl mitten in der Großstadt und im Hafengetriebe fischen sollen? Gösta erklärte mir später lächelnd, Sie fischen nur im Licht des Mondes, sie suchen die verlorenen Träume der Großstadt.
Wir mussten nun allmählich an den Heimweg denken. Etwas pflastermüde, aber voller neuer Eindrücke legten wir am Freitag, dem 18. Juni um 11 Uhr ab. Wir segelten durch den engen Djurgardsbrunnsviken, mussten noch einmal den Mast legen und waren mit Hilfe einer Motorjacht bald wieder draußen im Hauptfahrwasser des Hafens.
Bevor wir uns auf die endlose Kreuz Richtung Heimat begaben, mussten wir daran denken, das immer noch klemmende Schwert wieder in Ordnung zu bringen. Wir krochen also mit dem mehr als müden Wind in den Hafen der Kungl. Svenskt Seglar-Sellskab. Als wir die Einfahrt passierten, sauste sofort ein Bootsmann auf den Steg und setzte die Bundesflagge. Man war sehr hilfsbereit und lieh uns einen dicken Hammer und ein schweres Brecheisen, mit deren Hilfe wir in einstündiger Arbeit das Schwert Zentimeter für Zentimeter wenigstens ganz nach unten schlagen konnten. Wir mussten uns von jetzt ab sehr ängstlich vor der geringsten Grundberührung hüten, denn auf die Dauer konnte auch die solide Vertens-Konstruktion nicht solcher ständig wiederholten Gewaltanwendung widerstehen.
Wir hinterließen noch eine kurze Nachricht über unsere weiteren Pläne für unseren Klubkameraden Walter Rösler, der um diese Zeit etwa hierher kommen wollte und gingen wieder auf die große Fahrt.
Wie wir es fast schon erwarten konnten, wehte der Wind wieder aus südlichen Richtungen und war dazu noch sehr schwach. Es wurde uns dadurch unmöglich, das Duvnäsfahrwasser zu benutzen, wodurch wir viel Zeit gespart hätten. So mussten wir durch das große Hauptfahrwasser um Vaxholm.
Der Wind wurde immer schwächer und blieb schließlich ganz aus. Um uns war reger Verkehr von Schiffen, Motorjachten und Segeljachten mit Motor. Alle fuhren sie flott ihren Zielen zu, nur wir waren zur Untätigkeit verdammt. Unser Motor reagierte weder auf Drohungen noch auf gutes Zureden. Mit unseren besten Möhnsee-Flautensegelkünsten quälten wir uns langsam vorwärts.
Am Abend war es ganz aus. Wir wollten ein erhebliches Stück abkürzen, indem wir zwischen zwei Schären durchfuhren. Die Wassertiefe war an der flachsten Stelle der Durchfahrt mit 60 cm angegeben. Wenn wir dort ankamen, wollten wir einfach absteigen und uns einen Weg suchen. Beim Einlaufen hielten wir uns aber von einem Steg aus einen Segler an und fragte nach unserem Tiefgang. Als wir es ihm sagten und unsere Absicht erklärten, erzählte er uns, dass er das selbe auch schon erfolglos versucht habe. Da wir ohnehin nur Schwierigkeiten mit unserer krummen Blechplatte zu erwarten hatten, gaben wir es auf. Der freundliche Segler lud uns noch in sein - nach unseren Begriffen recht feudales - Landhaus zum Abendessen ein und zeigte mir auf der Karte verschiedene Stellen, an denen sich das Abkürzen lohnte. Hier jedenfalls nicht.
Am nächsten Morgen legten wir früh ab und schafften bis zum Abend ein Etmal von 44,5 sm, also wenigstens etwas. Wir sahen die Schären jetzt einmal von ihrer schönen Seite. Die Sonne schien, es war richtige sommerliche Ferienstimmung, die nur durch die Zeitknappheit beeinträchtigt wurde. Langsam glitten wir an unzähligen bewaldeten Insel vorüber. Auf vielen von ihnen standen hier in der Nähe der Großstadt nette kleine Häuschen, oft aber auch große massive Bauten mit gepflegten Parkanlagen. Zur Ausstattung einer einigermaßen wohlhabenden Familie, wie z.B. Tjulanders, gehört neben der Wohnung in Stockholm eine eigene Schäre mit Haus und meist auch einem Segelboot. Für die Fahrt dorthin ist dann oft auch noch ein Motorboot da. Die Schweden sind sehr sonnenhungrig und genieß0enb den Sommer, weil der Winter dort so lang ist.
Wir bedauerten, dass wir in dieser herrlichen Gegend nicht länger bleiben konnten. Zur Nacht machten wir an einer Schäre (Muskö) fest und erkundeten sie in einem ausgedehnten Streifzug.
Am Sonntag kamen wir allmählich wieder auf die offene See. Die Schären wurden weniger und lagen weiter auseinander. Sie waren nicht mehr bewaldet, sondern hatten eine Vegetation, die etwa der des Hochgebirges oberhalb der Baumgrenze entsprach. Wir hätten gern auch einen solchen "ytter-skägrd" erkundet, mussten uns aber für diesmal mit einem Entschluss trösten, später noch einmal hier her zu segeln.
Bald verschwanden die letzten Schären am Horizont. Der Wind wehte aus Süd bis Südost, so dass wir hoch anliegend einen Südwestkurs in Richtung Kalmar-Sund halten konnten.
Am Montagmittag wurde unser geruhsames Segeln jäh unterbrochen. Über den Horizont schob sich von Westen her eine drohende schwarze Wand heran. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Wir segelten weiter mit Vollzeug, bis der Wind ganz plötzlich vollständig aufhörte. Über uns wurde es drohend schwarz. In der Ferne donnerte es. Schnell setzten wir die Sturmsegel und bereiteten alles auf das Abwettern einer schweren Bö vor. Die Luft knisterte vor Spannung. Es war unerträglich schwül. Plötzlich blitzte es über uns und ein krachender Donner folgte. Dann - schwüle Stille, kein Lüftchen. Wir warteten. Da - ein leiser Hauch -. Jetzt musste es kommen. Nichts. VAGANT torkelte mit seine kleinen Besegelung unbeholfen in der toten Dünung.
Endlich kam der erlösende Regen und eine sanfte Brise begleitete ihn. Wir setzten wieder Vollzeug und kreuzten weiter.
Bei diesen Wetterverhältnissen konnten wir nicht damit rechnen, pünktlich nach Hause zu kommen. Helmut und Winfried mussten schon am 25. wieder ihre Arbeit aufnehmen. Wir mussten also unsere Pläne ändern.
Nach eingehender Beratung wurde der Beschluss gefasst, den nächsten Hafen, Västervik, anzulaufen.
Das war leichter gesagt als getan. Wir hatten keine Spezialkarte für die Ansteuerung des weit hinter einem Schärengürtel liegenden Hafens. Die von uns für den Törn über das offene Wasser benutzte Segelkarte der mittleren Ostsee enthielt nur Andeutungen. Der Beschreibung durch das Seehandbuch konnten wir entnehmen, dass äußerste Vorsicht angebracht war.
Wir erreichten die Ansteuerungstonne am späten Abend und liefen bei beginnender Dämmerung in das immer enger werdende Fahrwasser ein. Bei wieder mal abflauendem Wind segelten wir schließlich nah Leuchtfeuern weiter. Als Rasmus dann endgültig schlafen ging, machten wir an einer unbekannten Schäre fest und gingen in die Kojen.
Unser Liegeplatz war nicht gegen alle Windrichtungen geschützt. Einer dunklen Ahnung folgend brachten wir deshalb beide Anker aus. Wie richtig das war, zeigte sich bald. Mitten in der Nacht wurden wir unsanft aus unseren gemütlichen Schlafsäcken gejagt. Draußen war der Teufel los. Gleich mehrere Gewitter tobten um uns und ein scharfer Nordwind hatte sich erhoben, der mit der beginnenden Dünung unser Boot immer näher an die Felsen drückte. Die Anker hielten beide nicht einwandfrei, höchste Gefahr war im Anzuge. Das Boot musste mit dem Bug in den Wind. Lossegeln war Wahnsinn, ringsherum war alles voller Klippen. Ich band mir eine lange Leine um die Hüften, turnte über glatte überspülte Felsen so weit wie möglich nach Luv und schwamm schließlich etwa 30 m quer zur See auf einen Felsblock zu. Es schien mir eine Ewigkeit zu dauern, bis ich ihn endlich erreichte. Aber dann wurde es fast gefährlich. In der Dunkelheit fand ich an dem glitschigen Stein keinen Halt. Die Wellen spülten mich herunter, wobei es nicht ohne ein paar Schrammen abging. Irgendwie klappte es dann aber doch, und ich konnte meinen Leinen festmachen. Wir holten VAGANT in Lee des Felsens und lagen für den Rest der Nacht ruhig.
Am Morgen war der Wind wieder weg. Mit anstrengendem Kreuzen brachten wir den Rest der gewundenen Ansteuerung hinter uns. An der letzten Ecke war es zum Verzweifeln, dort stand eine starke Strömung. Jedes mal, wenn wir etwas weiter zur Mitte kamen, ging in Sekunden die mühsam erkreuzte Höhe von 10 Minuten verloren. Wir versuchten es wieder und wieder. Aber mit dem flauen Lüftchen war es nicht zu schaffen. Auch Mitpaddeln half nichts. Endlich kam eine Motorjacht und schleppte uns über das schlimmste Stück hinweg in die weite Bucht, die den Hafen von Västervik bildete. Wir segelten zum Jachtliegeplatz und machten neben einem schwedischen 22 qm Schärenkreuzer fest.
Winfried und Helmut, die bis hierher mit mir alle Freuden und Unbilden der Reise geteilt hatten packten ihre Sachen und gingen von Bord. Um 12.30 Uhr fuhr der Zug ab und ich stand allein mit gemischten Gefühlen am Steg mit meiner VAGANT.
Sollten wir es allein wagen? Er schien seinen kurzen Bug in die Höhe zu recken und zu sagen: aber klar! Ich war mir aber doch nicht ganz schlüssig, was jetzt zu unternehmen war. Das Boot musste unbedingt nach Deutschland zurück. Aber das war noch weit! Bei allem Zutrauen zu meinem Boot wusste ich doch nicht, ob ich es wohl allein schaffen konnte. Viele haben schon lange Seefahrten allein unternommen, aber das waren doch wohl meist erfahrene Salzbuckel oder verwegene Abenteurer. Den Ausschlag gab schließlich ein Schipper des Nachbarbootes, der mich zunächst einmal zum Mittagessen einlud. Es war Göste Hannerz aus Lulea, von Beruf Veterinärstudent und mit seiner Braut Lo-Lo unterwegs nach Borgholm zu ihren Eltern. Dort wollten die beiden heiraten (was sie inzwischen auch getan haben).
Gästa kannte die ganze Ostsee und hatte vor ihr nicht mehr Respekt als wir vor unserer Möhne. Vor einigen Jahren war er - allerdings mit seinem Bruder abwechselnd - von Lulea (Erzhafen im Norden des Bottnischen Meerbusens) bis Helgoland und zurück gesegelt. Das Kernstück seiner Ausrüstung war eine riesige eingebaute Lenzpumpe, deren Wert er wohl zu schätzen wusste. Wo VAGANT mit seinen kurzen Überhängen wie eine Ente oben auf schwamm, schnitt der schlanke Schärenkreuzer mit seinen langen, spitzen Überhängen die Wellen derart, dass er mitunter ganz unter zu tauchen schien, wobei natürlich mächtig Wasser überkam. Es machte Gösta und Lo-Lo aber gar nichts aus, bei etwas grobem Wetter von zehn Segelstunden etwa acht Stunden lang ununterbrochen zu pumpen.
Nach genügender Aufmunterung durch diesen Optimisten entschloss ich mich nicht nur, allein weiter zu segeln, sondern auch noch den ursprünglich geplanten Abstecher nach Gotland zu machen.
Am nächsten Morgen ging es los Nach ausgiebigem Frühstück an Bord von "Taifun" und herzlichem Abschied segelte ich gen Osten mit günstigen Winden in einen herrlichen Sommertag hinein.
Die anfängliche Spannung löste sich bald. Es dauerte nicht lange, bis ich herausgefunden hatte, wie Pinne und Schoten zu belegen waren, damit das Boot allein einen genauen Kurs steuerte. Ich gewöhnte mich rasch daran, keinen Schritt mehr aus dem Cockpit an Deck zu tun, ohne sorgfältig angeleint zu sein. Zusätzlich hatte ich, wenn ich bei Wind und Seegang mal an Deck musste, eine Schwimmweste an und in den Taschen etwas Schokolade und eine Flagge zum Winken, um auch im äußersten falle noch eine Chance zu haben.
Solange der Wind stetig blieb, lief VAGANT fortan unbeirrt geradeaus. So hatte ich Muße für die Navigation, konnte Seehunde, Möwen und einmal auch einen Tümmler beobachten. Wenn es erforderlich war, konnte ich auch schlafen. Ich legte mich dann auf einige Polster im Cockpit. Um den Kurs kontrollieren zu können, stellte ich genau meinem Gesicht gegenüber das Peilgerät mit seinem Kasten so auf, dass ich in dem Prisma die Peilung sehen konnte. Bei der geringsten Veränderung im Verhalten des Bootes wurde ich sofort wach. Ich brauchte dann aber erst gar nicht aufzustehen, sondern konnte mit einem Auge im Halbschlaf sehen, was los war.
Ganz besonders aber beschäftigte ich mich mit Kochen und Essen. An Bord war noch reichlich Verpflegung. Auf den oft recht langen Törns hatte ich Zeit genug, vollständige Mahlzeiten zusammenzustellen. Vorher Ochsenschwanzsuppe mit Champignons, dann Bratkartoffeln mit Spiegeleiern und Würstchen. Als Abschluss Pudding (den ich allerdings meist sofort flüssig aß, weil die Dünung kein langes Warten erlaubte) oder Kaffee. So ließ sich das schon aushalten.
An diesem ersten Tage, den ich allein auf See zubrachte, zeigte sich Rasmus von seiner besten Seite und holte einen richtig schönen Urlaubswind aus seinem großen Sack, der sonst so oft am falschen Ende aufging oder gar zu fest zugebunden war.
Västervik kam bald außer Sicht. Voraus fiel mir eine gewaltige, weit entfernte Wolkenbildung auf. Erst Stunden später erkannte ich darunter einen schmalen dünnen Strich: Gotland. Es dauerte noch drei weitere Stunden, bis ich nahe genug heran war, um die Hafenanlagen, Häuser, Kirchen- und Turmruinen der alten Hansestadt Visby erkennen zu können.
Um halb vier machte ich im Hafen fest. Wenig später tauchte am Horizont ein Segel auf, und nach zwei Stunden glitt ein 22 qm Schärenkreuzer elegant in den Hafen. Es war Gösta, der seine Absicht, nach Öland zu segeln geändert hatte und stattdessen mir gefolgt war. Wir vertäuten unsere Boote nebeneinander an den Gästebojen des Svenska-Kryssar-Klubben und machten den ersten Landbummel.
Visby ist eine der wenigen europäischen Städte, die, wie auch Soest, eine Stadtumwallung aus der Zeit vor etwa 1300 haben. Die Stadt ist eine Gründung der Hanse und zwar besonders deren westfälischer Hauptstädte Münster, Dortmund und Soest. Sie war der bedeutendste Stützpunkt für den Osthandel dieser Städte. Nachdem sich Visby in einem blutigen Krieg mit den Bewohnern der Insel siegreich auseinandergesetzt hatte, entwickelte sie sich zu einer der reichsten Städte Europas. Diese Blüte wurde 1361 jäh unterbrochen durch den Überfall des neidischen Dänenkönigs Waldemar Attertag. Die Stadt wurde nach hartem Kampf genommen und zerstört. Ihre Bedeutung war dahin. Nur als Seeräubernest machte sie sich noch einmal einen unrühmlichen Namen, bis die Lübecker die Geduld verloren. Sie eroberten sie und steckten sie zum zweiten Mal in Brand.
Noch heute ist dies von den Lübschen Kriegsknechten in die Maier gerammte Loch zu sehen.
Die Stadt erholte sich nun nicht mehr. Die Kirchen, Mauern und Speicheranlagen wurden nicht wieder hergestellt. Ihre Ruinen stehen noch heute so da, wie vor 600 Jahren.
Solange war es nun wohl auch schon her, dass ein Schiff unter der Flagge der Hansestadt Soest im Hafen von Visby lag. Das war für mich ein eigenartiges Gefühl, obwohl ich wusste, dass sich die Insel seit dem gehoben hatte, so dass dort, wo damals die Karavellen schaukelten, heute Tennis gespielt wird.
Der nächste Tag brachte mir eine besondere Überraschung. An der Kimm tauchte ein Segel auf, das mir nicht unbekannt erschien. Es kam schnell näher und brauste in den Hafen: Inga II - Walter Rösler aus Soest. Das war ein Zusammentreffen! Wir feierten schrecklich und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich an Bord zurück gekommen bin.
Dann war es plötzlich aus mit der Gemütlichkeit. In der Nacht erwachte ich. Das Boot dümpelte schwer und im Rigg heulte es unheimlich. Südwest-Sturm. Da die Haupteinfahrt nach Südwesten offen ist, stand im Hafen eine mächtige Dünung, die sich bis in unseren versteckten Winkel unangenehm bemerkbar machte. Das Heulen in der Takelagen der dort liegenden Boote schwoll zu einem höllischen Konzert an. Gegen die Mole, die unser Hafenbecken gegen die See abschirmte, krachten gewaltige Brecher. Sowohl Göstas als auch meine Achterleinen brachen. Die dicken Bojen, an denen wir nun allein hingen, wurden unter Wasser gezogen. Wir fürchteten um unsere Boote. In mühsamer Arbeit vertäuten wir sie gemeinsam an einer zusätzlichen langen Trosse. Als Verbindung zum Land brachten wir meine Ankerkette aus. Sie brach zweimal, bis wir sie gegen allzu hartes Einrucken durch einen in der Mitte drangehängten Anker sicherten. Mit Göstas Windmesser maßen wir auf der Mole 28 Metersekunden, das entsprach Windstärke 11. Die über die Mole wehende Gischt machte in Verbindung mit dem starken Wind jeden Gang an Land zu einem gewagten Unternehmen. Wenn man nicht genau die Pause zwischen zwei Brechern abpasste, wurde man völlig durchnässt.
Das Wetter zwang mich zu einer nicht vorausgesehenen Unterbrechung der Reise und damit Überschreitung meines Urlaubs. So peinlich das auch war, um so ausgiebiger konnte ich mich mit Visby befassen.
Ich besichtigte die Kirchenruinen, Mauern Tore, Türme und Häuser. Besonders bemerkenswert war ein vielhundertjähriges Holzhaus. Außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe liegt "Sjutton-Stenar", die Hinrichtungsstätte.
Die Balken des Galgens wurden von drei Pfeilern getragen, die aus je 17 Steinen bestanden. Siebzehn = Sjutton ist im Schwedischen ein böses Wort.
Überall in Visby sieht man, wenn man nur etwas höher steht, das Meer.
Unter Führung eines - ausgerechnet französischen Professors sah ich die Marienkirche mit ihren deutschen Inschriften auf Bildern und Grabsteinen aus der Hansezeit. Ich besuchte das Museum mit seiner einzigartigen Sammlung der Funde aus der Geschichte Gotlands.
Diese Funde spielen hier eine besondere Rolle. Man sagt, dass auf jedem Bauernhof in jeder Generation wenigstens ein Fund gemacht wird. Die Bewohner waren in der Wikingerzeit große Seefahrer. Sie befuhren damals alle bekannten Meere, trieben Handel oder raubten und plünderten. Aus dieser Zeit findet man heute noch Münzen, Schmuck, Geräte und Waffen aus der ganzen frühmittelalterlichen Welt, von Frankreich und Spanien über Ägypten, Arabien, Griechenland, Italien und Deutschland bis England. Man findet aber auch viele Runensteine mit den eingemeißelten Taten derer, die von einer der verwegenen Fahrten nicht zurückkehrten.
In einer besonderen Abteilung des Museums werden Funde gezeigt, die mit der Belagerung und Zerstörung Visbys durch Waldemar Attertag zusammen hängen. Neben Rüstungen, Helmen, Kettenhemden und Waffen aller Art liegen da abgehauene Beine und Arme, gespaltene Schädel und zerquetschte Brustkörbe aus einem Massengrab, das vor einigen Jahren entdeckt wurde. Grausige Dinge, über deren Zurschaustellung man verschiedener Meinung sein kann. Immerhin sind sie trotz ihres Alters geeignet, die kriegsverschonten Schweden an das zu erinnern, was seit Jahrhunderten an ihnen vorbeigegangen ist, ohne sie selbst zu treffen.
Es lohnt sich, Visby und Gotland zu besuchen, obwohl zu merken ist, dass viel für den Fremdenverkehr getan wird. Es gibt schon Anzeichen der Andenkensuche, alles ist wohl organisiert, Ruinenbesichtigung nach Tarif mit Mengenrabatt, eine Ruine 50 Öre, frei Ruinen eine Krone. Im benachbarten Snäckgärdsbaden ist das Meer nicht mehr fein genug zum Schwimmen. Es gibt dort ein exklusives Schwimmbad hoch auf den Felsen, mit garantiert echtem, gefiltertem und geheiztem Meerwasser und Original-Wellenschlag. Ob sie das wohl nötig haben? Gotland hat nach langen Beobachtungen im Sommer die meisten Sonnentage von allen Ostseeinseln.
Der Sturm begann nachzulassen, wenn auch an Auslaufen noch nicht zu denken war. Dafür bekam ich durch das Entgegenkommen schwedischer Segler endlich das verbogene Schwert gerichtet. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, als plötzlich jemand kam und mir mitteilte, dass mein Boot gleich aus dem Wasser geholt würde. Ich hatte gerade noch Zeit, den Mast zu legen, da kamen schön fünf Mann, Angehörige des Visbyer Segelvereins und des Svenska Kryssarklubben, VAGANT wurde verholt und wenige Minuten später schwebte er schon über der Pier. Unter tatkräftiger Mitwirkung von Herrn Rösler wurde mit einem dicken Balken und zwei gewaltigen Hämmern die Platte so gerade geschlagen, dass ich auf dem Rest der Reise keine Schwierigkeiten mehr damit hatte.
Bezahlung kam nicht in Frage. Nur eine Flasche "Eau de vie" wurde ich los. Ich schämte mich ein bisschen, dass ich mich für so viel Hilfsbereitschaft ausgerechnet nur mit diesem Zeug revanchieren konnte. Aber die Schweden vertrugen wohl einiges. Da das Trinken, gefördert durch den langen, vielerorts sehr öden Winter eine Schwäche aller Nordländer zu sein schien, bestand in Schweden bis 1955 eine Alkoholrationierung. Spirituosen gab es in beschränktem Umfang nur auf ein besonderes Buch, dass man erst von einer bestimmten Altersgrenze an erhielt. Kaufen konnte man nur in den Verteilungsstellen der staatlichen "Systemaktiebolaget", vor deren Türen zu Beginn der Zuteilungsperioden regelrechte Schlangen zu beobachten waren.
Der Sturm ließ inzwischen weiter nach. Am Tage vor meinem Auslaufen kam hoher Besuch: der dänisch König lief mit seine Jacht "Danebrog" zu einem privaten Besuch ein. Wie ich erst jetzt erfuhr, wurde für den 30.6. mittags eine totale Sonnenfinsternis vorhergesagt, die er wohl beobachten wollte.
Als ich am nächsten Tage, dem 29. Juni auslief, lagen Gösta und Lo-Lo noch in ihren Kojen. Wir hatten verabredet, uns an einem Punkt nördlich Öland zu treffen, um dann gemeinsam weiter zu segeln.
Beim Verlassen des Hafens empfing mich frischer Wind und ein grober Seegang, der noch von dem Sturm übrig geblieben war. Im Laufe des Tages legte Rasmus sogar noch erheblich zu, so dass ich daran gehen musste, die Segelfläche zu verkleinern. Es war nicht ungefährlich, auf dem wild tanzenden Boot das Vorsegel auszuwechseln. Ich setzte mich dazu so auf das Vorschiff, dass ich am Vorstag festhalten konnte. Außerdem war ich natürlich durch eine Sorgleine gesichert und hatte eine Schwimmweste um.
Als das zu bergende Segel herunter kam, drehte VAGANT sofort in den Wind. Von vorn kam ein Brecher, der mich fast herunterfegte und VAGANT sofort zum Stehen brachte. Er drehte quer zur See und das belegte Großsegel bekam wieder Winddruck. Bevor das Boot wieder Fahrt aufnehmen konnte, kam der nächste Brecher. Gemeinsam mit dem Wind legte er VAGANT so flach, dass ein mächtiger Schwall Wasser ins Kockpit lief. Ich Häufchen Unglück konnte mich nur ans Vorstag klammern und warten, bis nach dem Durchlaufen der See der Ballast das Boot wieder aufrichtete. Sicher dauerte das Ganze nur Sekunden. Mir schienen es aber Stunden, bis VAGANT sich mit einem fast unwilligen Ruck wieder hinstellte.
Das Großsegel knatterte. Ich holte es schnell herunter und drehte erst einmal bei. Dazu war eigentlich etwas Segelfläche nötig, aber ich hatte die Nase voll. Zunächst steckte ich alles, was ich an Leinen hatte nach Luv, dazu den Treibanker. Es war erstaunlich, wie ruhig das Boot jetzt die hohen Wellen abritt. Nur der Treibanker brachte mitunter harte, ruckartige Stöße. Ich konnte in Ruhe lenzen und ein Reff eindrehen. Nach einiger Zeit gelang es mir, zuerst die Sturmfock und später auch das Großsegel zu setzen.
Mit rauschender Fahrt lief ich weiter und erreichte bald den vereinbarten Treffpunkt. Obwohl kein Land zu sehen war, gebärdete die See sich hier doch nicht ganz so wild, da Öland nicht weit in Luv lag.
Ich brauchte nicht lange zu warten. Im Osten tauchte ein Segel auf und kam rasch näher. Gösta. Die beiden hatten es nicht leicht. Der schlanke und niedrige Schärenkreuzer fuhr mit seinen langen Überhängen mehr unter als über Wasser. Lo-Lo bediente wohl schon seit Stunden die eingebaute gewaltige Lenzpumpe.
Bald lagen wir nicht mehr weit auseinander und Göta fragte mich ironisch, wo ich denn all meine 30 Quadratmeter Segel hätte. Ich entgegnete ihm, dass ich sie schon vorsorglich eingepackt hätte, um sie ihm zum Staubwischen in seiner bestimmt der trockenen Bilge zur Verfügung zu stellen.
Es war ein eindrucksvolles Bild, sein langes, schlankes Boot im Seegang tanzen zu sehen. Gösta wollte mir eine Spezialkarte für die Einfahrt nach Grankullaviken an Ölands Nordspitze geben. Er kam auf sein Vorschiff und Lo-Lo steuerte das Boot vorsichtig von achtern an VAGANT heran. Ich erwartete ihn an Achterdeck. Gösta hatte die Karte in der Hand und versuchte, sie rüber zu geben. Es war unmöglich, obwohl wir uns nur auf einen Meter Entfernung gegenüber standen. Die gegenseitigen Bewegungen der Boote waren derart heftig, dass ich dauernd ins Leere griff. Um zu Werfen war der Wind zu stark. Ich steckte schließlich ein Stück Leine an eine Aktentasche und warf sie hinüber. Jetzt klappte es. Gösta fing sie und steckte die Karte hinein. Beim Zurückholen fiel die Tasche zwar ins Wasser, bevor sie aber vollaufen konnte, hatte ich sie geborgen.
Nun segelten wir gemeinsam ins Grankullaviken. Unter Land wurde der Wind mit einem Male sehr schwach. Die Einsteuerung war nicht leicht. Nach Durchlaufen einer Steinbarriere tat sich eine stille, weite Bucht auf. Ringsherum dunkler, hoher Wald, das Ufer übersät mit Findlingen. Das Wasser still wie ein Bergsee. Aber äußerste Vorsicht war geboten. Es wimmelte nur so vor Unterwasserhindernissen. Mit unzähligen Kreuzschlägen in einem stellenweise nur 10 Mater breiten, gewundenen Fahrwasser ging es weiter. Es dauerte fast eineinhalb Stunden, bis ich endlich an der Brücke eines Sägewerkes festmachen konnte.
Gösta lag schon da und kaute auf beiden Backen. Er kannte hie jeden Stein unter Wasser und war mit seinem wendigen Boot ohne Rücksicht auf die Fahrrinne quer über den Acker gesegelt.
Ich hoffte, am nächsten Tag zu der angekündigten Sonnenfinsternis die Bla Jungfrun zu erreichen. Infolge der anstrengenden Überfahrt von Gotland schlief ich aber so fest und lange, dass ich erst gegen 10 Uhr auslaufen konnte. Gösta und Lo-Lo erging es genau so. Sie liefen sogar noch später aus.
Draußen wehte ein frischer Südwestwind, gegen den ich ankreuzen musste. Es dauerte nicht lange, da überholte mich TAIFUN. Lo-Lo war schon wieder eifrig mit der Pumpe beschäftigt.
Um 13.25 Uhr passierte ich die auf offener See vor Anker liegende "Danebrog". ich dippte meine kleine Bundesflagge. Sofort schrillte an Bord der Königsjacht eine Bootsmannspfeife, ein weißgekleideter Matrose sauste nach Achtern und dippte als Antwort die riesige dänische Flagge.
Mittlerweile war die Sonne bereits zu zwei Dritteln verdeckt. Es dämmerte. Eine dünne, aber geschlossene Wolkendecke bedeckte den Himmel. Sie wirkte wie ein Filter, so dass die Sonne ohne Blendgefahr gut zu beobachten war. Die Bla Jungfru konnte ich nun nicht mehr rechtzeitig erreichen. Die Insel lag in der zunehmenden Dunkelheit riesengroß vor mir.
Plötzlich nahm der Wind stark zu. Mir war das jetzt gleichgültig. Erregt von dem einmaligen Schauspiel stand ich auf dem steilen Deck, gestützt auf die Pinne, um ringsherum alles sehen zu können. Es wurde immer dunkler. Solange aber noch so ein kleines Stück der Sonne leuchtete, war es dämmerig. Dann kam der große Augenblick. Von Westen her jagte mit unvorstellbarer Geschwindigkeit ein gewaltiger schwarzer Schatten über die See. Das letzte Stückchen Sonne verschwand, nur eine schwarze Scheibe mit einem gedämpft leuchtenden Rand war noch zu sehen.
Schlagartig wurde es finstere Nacht. Rings um den Horizont ein goldener Ring Tageslicht. Die brechenden Kämme der Wellen, VAGANT´s Bug- und Hecksee glühten geisterhaft. Meeresleuchten.
Die Dunkelheit verschwand nach wenigen Minuten so schnell, wie sie gekommen war. Urplötzlich war eine graue Dämmerung da. Die Wolkendecke hatte sich inzwischen so verdichtet, dass am Himmel nichts mehr zu erkennen war. Bald wurde es heller und heller. nach kurzer Zeit war wieder ein ganz normaler Sommertag mit bedecktem Himmel. Ich lief zu einem kurzen Besuch Bla Jungfrun an. Dort hatten sich erstaunlich viele Leute zusammengefunden. gerade stieg unter dem Salut seiner Leute der Kommandant eines draußen ankernden Zerstörers in seine kleine Barkasse und ein Fischkutter voller offensichtlicher Landratten legte ab.
Die Zeit drängte, ich musste bald weiter. nachdem ich mich mit Gösta in Borgholm verabredet hatte, ging ich sofort wieder auf die Kreuz mit Kurs Süd.
Abends nahm wieder einmal der Wind stark zu. Eine unheimlich dunkle Nacht brach an. Ich fühlte mich etwas unsicher. An beiden Seiten unbekanntes Land, voraus die engste Stelle des Kalmar-Sundes. Zu allem Überfluss fiel auch noch die Positionslaterne und schließlich sogar die Kompassbeleuchtung aus. Es hatte nicht viel Zweck, weiter zu segeln. Ankern ohne Licht war aber auch gefährlich in dieser belebten Wasserstraße. Ich entschloss mich, den Hafen Sandvig anzulaufen, der schon etwas hinter mir lag.
Für die Einsteuerung musste wieder mal die große Karte herhalten, mit der wir uns nach Västervik hinein gemogelt hatten. Im Seehandbuch stand außerdem etwas von zwei roten Leitfeuern. Aber stimmte das auch noch? In den 12 Jahren seit seiner Herausgabe konnte sich sehr viel geändert haben.
Ich steuerte erst einmal dorthin, wo der Hafen nach meiner Berechnung liegen musste. Den Kompass beleuchte ich hin und wieder mit einem Blitz des Gasanzünders. Im Übrigen steuerte ich nach Gefühl, bis voraus tatsächlich ein rotes Licht in Sicht kam. Nach einiger Zeit sah ich auch das Zweite. Ich segelte nun weiter, bis beide Lichter genau übereinander standen. Dann ging es mit Brassfahrt genau vor dem Wind darauf zu. Den Hafen selbst oder überhaupt das Land konnte ich noch nicht erkennen. Die Entfernung zu den Leuchtfeuern war nicht zu schätzen. Weiter raste das Boot ins schwarze Nichts, auf die beiden roten Leuchten zu. Die tollsten Möglichkeiten zuckten mir durch den Kopf. Was tue ich wenn...? Wenn es zum Beispiel nicht der Hafen von Sandvig war, sondern nur eine Kabelpeilung? So etwas war hier in der Nähe auf der Karte eingezeichnet. Ich sah VAGANT schon krachend in der Brandung zerschellen.
Immer noch nichts zu sehen. Schließlich wurde es mir zuviel. Ich nah die Segel weg und ließ mich vor Top und Takel weitertreiben. Das Boot machte so vor dem Wind immer noch genügend Fahrt. Ich stand auf dem Achterdeck und hatte einen Anker wurfbereit in der Hand, für alle Fälle.
Plötzlich stockte mir fast der Atem. Brandung voraus! Ehe ich mir etwas einfallen lassen konnte, war ich schon heran. Gott sei Dank, es waren die Molenköpfe der Einfahrt. Ich war genau in der Mitte zwischen Ihnen.
Glücklich und müde ließ ich mich noch ganz in den Hafen treiben und warf, um besser verholen zu können, wenn ich jemandem im Weg lag, beide Anker. Nachdem ich noch einer Vorleine an der Heckreling einer Galiot festgemacht hatte, fiel ich in die Koje und schlief sofort tief und fest ein.
Plötzlich wurde ich wach. Irgend etwas Ungewöhnliches war los. Schlaftrunken versuchte ich es zu verstehen. Das ganze Boot vibrierte. Raus aus dem Schlafsack, Schiebeluk auf und Kopf raus. Da hatte ich die Bescherung: die Galiot lief aus und schleppte mich am Festmacher hinter sich her. Meine beiden Anker pflügten den Grund. Ihre Leinen standen zum Brechen, aber sie hielten. Ich holte das Nebelhorn raus und begann zu tuten. Unbeirrt steuerte das Schiff der Ausfahrt zu. Ich tutete, dass sicher ganz Sandvig erwachte - ohne Erfolg. Der Steuermann hatte vielleicht eine dickere Mattscheibe als ich. Es half nichts, Messer raus, Leine kappen. Das war nicht leicht, da es sich um ein Stück eines ehemaligen 13-mm-Kletterseiles aus starkem Hanf handelte. Feucht war dieser Tampen hart und steif wie Holz. Schließlich gab er aber doch nach und die Galiot rauschte davon.
Ich ließ das Boot liegen, wie es lag und kroch sofort wieder in die Koje.
Erst gegen Mittag segelte ich weiter. Ich wäre besser früher aufgestanden, denn so geriet ich in eine nervtötende Flaute. Drei Stunden lang dümpelte das Boot in der toten Dünung auf der Stelle umher. Mehrmals trieb ich auf die Küste zu und wieder ab. Wie um mich zu narren tauchten bei jedem Wegtreiben einige der typischen Windmühlen Ölands und eine alte Kirche auf, um beim Näher kommen wieder hinter der Küste zu versinken. Endlich, um 7 Uhr abends begann es wieder zu wehen. Natürlich gegenan aus Süd. Ich kreuzte in großen Schlägen weiter, überquerte die Slottsbredan-Untiefen, auf denen ein fürchterlicher kurzer und steiler Seegang stand und erreichte bald Borgholm.
In diesem Hafen wurde es spannend. Ich brauste vor dem Wind mit ausgebaumter Fock hinein. Weit hinten lag der Jachthafen. Als ich ihn erreichte, halste ich und segelte raumschoots mit erhöhter Fahrt in das enge Becken. Alles lag voller Jachten. Sie hatten über die Toppen geflaggt, da auch der dänische König inzwischen hier angekommen war. Ich wusste gar nicht, wohin mit meiner Geschwindigkeit. Aber es klappte: Wende, während der Drehung Fock runter, Halse, wieder Wende, blitzschnell das Großsegel runter. Genügend Fahrt im Schiff, um zwischen den dicht liegenden Booten eine kleine Lücke anzusteuern. Schnell noch einen Anker achteraus und mit dessen Leine bremsend kam ich genau bis zur Pier. Uff, das war geschafft. Am Signalmast hing die Bundesflagge hoch. Leider hatte ich keine Zeit, mir Borgholm und sein Schloss näher anzuschauen. Da Gösta nicht kam, segelte ich am nächsten Mittag weiter nach Kalmar, wo ich Post erwartete. Hier traf ich einen alten schottischen Gentleman mit seiner Frau, dem ich schon früher in den Schären begegnet war. Er fuhr ein klobiges, rundes Schwertboot mit geräumiger Kajüte, gelohten Segeln und starkem Motor. Mit diesem zuverlässigen Schiff segelten die beiden Alten jedes Jahr im Sommer ein weiteres Stück an den skandinavischen Küsten entlang. Wir "had a little drink", zu dem ich leider nicht mehr viel beisteuern konnte. Ich traf ihn 1955 in Helsingborg wieder.
Die Nachrichten von zu Hause waren nicht sehr beruhigend. Ich musste mich beeilen und lief am nächsten Morgen aus mit dem festen Vorsatz, wenn möglich bis Deutschland durchzusegeln.
Dabei hatte aber nun Rasmus ein wichtiges Wort mit zu reden. Er machte e mir nicht leicht. Nach anfänglich gutem Wind kam wieder einmal Flaute. Diesmal ohne Dünung, so dass ich aus der Not eine Tugend machen konnte. Ich schrubbte das Schiff gründlich von innen und außen. Anschließend nahm ich ein ausgiebiges Bad und verarbeitete auch das Unterwasserschiff. Selbstverständlich konnte ich auch jetzt keinen Schritt tun, ohne durch eine Leine gesichert zu sein. Wenn ich erst einmal außenbords war, würde ein leiser hauch genügt haben, um das Boot unerreichbar fortzutreiben.
Nach Stunden begann es wieder zu wehen. Natürlich von vorn, aber es frischte doch so stark auf, dass ich hart am Wind kreuzend gut voran kam.
Am Abend stand ich kurz vor der Hanö-Bucht. Der Wind ging schlafen. Ich versuchte schnell, einen kleinen Fischerhafen anzulaufen. Zwecklos. Drei Seemeilen vor der Küste blieb ich liegen. Blutroter Sonnenuntergang, Flaute, tote Dünung. Meine Hoffnung auf eine schöne Nachtbrise wurde enttäuscht. Um nicht durch Strömung versetzt zu werden, entschloss ich mich schließlich zum Ankern und versuchte, in dem dümpelnden Boot, als Nachtmusik das Klirren der Ankerkette, etwas zu schlafen.
Am Morgen, es war wieder einmal Sonntag, segelte ich mit dem ersten Hauch weiter. Rasmus hatte diesmal ein Einsehen und schickte Winde aus vorwiegend südlicher Richtung, so dass ich fast ganz über die Hanö-Bucht kam. Fast, denn in der nächsten Nacht war es wieder einmal ganz aus, und zwar diesmal besonders gründlich. Die Küste war noch nicht in Sicht. Es wurde dunstig und schließlich neblig. Von Süden her rollte eine unverändert hohe Dünung heran. VAGANT schlingerte entsetzlich. Mitunter legte er sich so weit über, dass Wasser an Deck kam. Alle Versuche, das Boot mit dem Bug gegen die See zu halten, misslangen. Ich musste die Segel bergen, Fallen, Dirk, Flaggleine und was sonst schlagend schamfielen konnte vom Mast wegbinden. Die Schaukelei wurde schließlich so heftig, dass die Wantenspanner begannen, sich unter den weit ausholenden Bewegungen des Mastes zu lösen. Jede Bewegung wurde zur Qual. Sobald ich mich erhob, musste ich wie ein Seiltänzer aufpassen, um nicht von den fast unberechenbaren Stößen in irgendeine Ecke oder gar über Bord geschleudert zu werden. Schlafen war unmöglich, Essen konnte ich mir nur unter großen Schwierigkeiten zubereiten.
Ich begann zu verstehen, dass diese Lage eine der furchtbarsten war, in die ein Segelschiff früherer Zeiten geraten konnte. Kein Vorwärtskommen, nur dieses entsetzliche Dümpeln. Die Wellen müde, bleiern, lautlos von irgendwo heranrollend. Das furchtbare Fegen des Mastes, das Schlagen von Tauwerk, Klappern und Rollen irgendwelcher Gegenstände unten im Schiff. Und nichts dagegen zu tun. kein Schlaf. - Warten. -
Plötzlich war da etwas. Ich lauschte angestrengt. Ein fernes tiefes Tuten. Ein Schiff im Nebel. Nach einer Weile tutete es wieder, diesmal näher. Da, wieder, und noch näher. Jetzt hörte ich das Rauschen einer Bugwelle und das Arbeiten einer großen Maschine. Es kam näher. Da brach durch den Dunst ein Dampfer genau auf mich zu. Ich griff zum Nebelhorn und tutete, was ich konnte. Er kam näher. Wenn er mich nun rammte? Oder auch nur streifte? Es sah ganz danach aus. - Ich langte mir die Pistole aus der Ecke, wo sie leise vor sich hin rostend lag und war entschlossen, dem Kasten ein paar Schuss auf seine Brückenfenster zu knallen, wenn er nicht bald . . . da drehte er leicht ab. Mit einer kleinen Schwenkung schob sich der Riesenkasten höchstens 10 Meter von mir entfernt vorbei. Für einen wohltuenden Augenblick wurde die Dünung unterbrochen, dann kam ein gewaltiger Schlag: die Heckwelle. Es war vorbei. Der Dampfer verschwand im Nebel und dich war wieder allein.
Bleiernd rollte die Dünung. Es begann zu regnen. Kein erlösender Schauer, sondern gemeiner, kalter Nieselregen. Immer noch kein Wind. -
Elf Stunden dauerte es, dann kam endlich der erste müde Hauch. Wohl nie hatte ich bisher das leichte Kräuseln des Wassers so dankbar begrüßt wie jetzt. Sofort gingen die Segel hoch und bald steuerte ich mit einer handigen Brise weiter auf Kap Sandhammeren zu.
Die Herrlichkeit dauerte nicht lange. Es flaute ab, als ich gerade die sandige Ecke erreicht hatte. Die Sonne brütete. Vom heißen Land her kamen die letzten kurzen Puffs, mit deren Hilfe ich noch etwas vorwärts kam. Irgendwo musste es mehr geweht haben, denn von Süd her kam immer noch eine gewaltige tote Dünung. Mit dem schwachen Wind war nicht dagegen an zu kreuzen. Ich konnte keine Höhe halten. In stundenlanger Kreuz schaffte ich bis zum Abend kaum eineinhalb Seemeilen. Eine Seemeile vor dem kleinen Hafen Kaseberga war es ganz aus. Unmittelbar neben einer roten Spierentonne blieb ich liegen. Kein Hauch mehr, nur die hohe Dünung und das unheimliche Klirren der Kette des Seezeichens. Es dunkelte. Der Horizont verschwamm in den ohne Pause lautlos heranrollenden gläsernen Bergen.
Irgendwo schwankte ein Licht. Wahrscheinlich schwankte es nicht, denn es musste ein Hafenfeuer sein. Ich konnte das nicht mehr genau unterscheiden.
Jetzt war ich es leid. Der Erschöpfung nahe, blies ich das kleine Schlauboot auf, steckte eine lange Schleppleine und begann, VAGANT Richtung Hafen zu pullen. Unwirklich torkelte er im Schimmer der sternenklaren Nacht hinter mir her. Ich hielt auf das Licht zu. Die Wellen hoben und senkten mich. Oben warf ich jedes Mal einen kurzen Blick auf mein Ziel, unten sah ich nichts als Wasser und Sterne über mir. Es dauerte noch zwei Stunden, bis ich endlich die Hafeneinfahrt passierte. Ich machte irgendwo fest und fiel sofort in einen festen traumlosen Schlaf.
Plötzlich klopfte es. Wer konnte es wagen!?! Wütend steckte ich den Kopf aus der Luke. Draußen war heller Tag und auf der Pier stand lächelnd ein Herr, dem man trotz seines Zivils den Polizisten von Weitem ansah. Es war derselbe Beamte, der uns vor Wochen aus Gislövs-Läge und, wie mir jetzt dämmerte, auch 1952 aus Skanör gewiesen hatte. Auch jetzt meinte er, ich müßte sofort raus. Ob ich nicht gesehen hätte, dass hie reine militärische Anlage wäre? Nein. Außer zwei besoffenen Seeleuten, die mir in der Nacht unbedingt noch klar machen wollten, dass Deutschland versehentlich Fußballweltmeister geworden war, hatte ich nichts gesehen. Ich müßte aber sofort raus, wiederholte er, wobei er eine besonders gebieterische Betonung auf das Wort "raus" legte. Erst als ich ihn bat, er solle mir Wind oder ein Schleppfahrzeug zur Verfügung stellen, gab er sich vorläufig zufrieden, blieb aber so lang da, bis ich mit dem ersten Hauch wirklich auslief.
Ich segelte mit gutem Wind nach Ystadt, um dort endgültig richtig auszuklarieren. Hier traf ich zwei nette Burchen, die vor kurzem mit ihrem sehr sauber selbstgebauten 20-qm-Jollenkreuzer aus der Ostzone hierher geflohen waren. Sie hatten gute Arbeitsstellen. Ihr einziger Kummer war, dass der Zoll das Boot nicht ohne Zahlung einer erheblichen Summe freigeben wollte. So kamen Sie, wie auch jetzt gerade, hin und wieder, um das mit so viel Liebe gebaute Stück in Ordnung zu halten. Wir hatten einen netten Abend zusammen. Sie erzählten mir eine kürzlich vorgefallene, in Ystadt viel belachte Geschichte.
Vier ostzonale Fischkutter hatten en Hafen wegen Sturm anlaufen müssen. An Bord waren fast nur Fischereischüler, die von ihren Ausbildern besonders politisch stark unter Druck gehalten wurden. Als sie nun in dem schwedischen Hafen festgemacht hatten, gingen sie einfach von Bord und bekamen innerhalb weniger Stunden feste Heuer auf gleichfalls dort liegenden schwedischen und westdeutschen Kuttern. Übrig blieben drei Mann, die mit einem der Boote zurückfuhren. Als sie einige Zeit später mit neuen Besatzungen zurückkehrten, um die restlichen Kutter zu überführen, liefen wieder mehrere Leute davon, so dass jetzt noch immer ein Boot dort lag. Als ich den einen der beiden im nächsten Jahr wieder traf, erzählte er mir den regst der Geschichte. Einige Wochen später war ein Kutter mit ausgesuchten Leuten gekommen. Nur der Kapitän ging an Land, um die Formalitäten zu erledigen. Beim Ablegen sprangen dann aber doch zwei der drei Besatzungsmitglieder über Bord, so dass der Kutter abgeschleppt werden musste.
Ich wäre gern noch geblieben, aber die Zeit drängte. So verließ ich am nächsten Tag, Mittwoch, dem 7. Juli Ystadt und damit Schweden endgültig zum letzten Abschnitt der Reise.
Mit schwachen, allmählich auf Nord bis Nordost drehenden Winden ging es südwärts. Es war sehr flau, bis Moens-Klint achteraus lag. Dann begann es endlich mal wieder richtig aus der richtigen Ecke zu wehen. In der Nacht zum Freitag kreuzte ihm um Mitternacht die Einsteuerung in den dänischen Hafen Gedser, eine hellerleuchtete Alle von Leuchttürmen und Leuchtbojen. Im Morgengrauen stand ich vor der Küste von Lolland und lief zu einer kurzen Pause Rødbyhavn an. Nachdem ich etwas geschlafen, Post geholt und einen großen Karton der schönen dänischen "Smakager" gekauft hatte, an denen man sich so schön den Magen verderben kann, segelte ich noch am gleichen Nachmittag weiter.
Als erstes Stück Deutschland passierte ich bald Fehmarnbelt-Feuerschiff. Wind und Seegang nahmen erheblich zu. Ich hätte eigentlich reffen sollen, konnte mich aber nicht dazu entschließen, da mit leicht killendem Großsegelvorliek Vollzeug zu halten war.
Mit brausender Fahrt ging es den Dampferweg entlang. Als es dunkelte, musste ich daran denken, die Positionslaterne zu setzen. Nach Versagen der Petroleumleuchte hatte ich mir etwas Elektrisches zusammengebastelt. Die Laterne stand ständig am Bug, und dich brauchte nur unter Deck den Stecker einzustecken. Das ist so leicht gesagt. Als ich nun aber runter Deck ging, lief mir VAGANT in der groben See sofort aus dem Ruder und zwar derart, dass er fast eine riesengroße Zwangswegtonne gerammt hätte. Die Dinger liegen ungefähr 5 Seemeilen auseinander, also war genug Platz. Es musste hier wohl die gleiche magische Anziehungskraft wirken, wie sie beim Skilaufen ein einzelner Baum auf die Läufer ausübt.
Um 22 Uhr lag Kiel-Feuerschiff hinter mir und bald war ich in dem fast beängstigendem Verkehr in der Förde. Ich wollte Strande anlaufen und erreichte auch bald die Strander Bucht. Aber wo war der Hafen? Außer der hellerleuchteten Front eines Restaurants war nichts zu sehen. Ich segelte noch näher heran. Im Schein er Positionslampe leuchtete heller Grund herauf, ich musste vorsichtig sein. Da war es auch schon passiert: ein kurzes Scharren und VAGANT saß fest. Schwert hoch - fein, wie es jetzt funktionierte - und Schooten dicht. VAGANT legte sich derart über, nahm etwas Fahrt auf, wieder das unangenehme Scharren - er war< frei. Vom Hafen noch immer nichts zu erkennen. Voraus dunkle Schatten. Zwei Schiffe ohne jede Beleuchtung. Spielten die hier Krieg? Ich rief hinüber. Sie antworteten, ich solle vorsichtig weg segeln, es sei sehr flach hier. Leicht erschüttert über soviel Unvorschriftsmäßigkeit auf einmal machte ich kehrt und segelte über die Förde nach Laboe. Hie meldete ich mich beim Zoll. Die Beamtens sagten, ich sei ihnen schon angekündigt worden. Ein Holländer und eine Däne hatten ihnen gemeldet, von draußen käme noch ein ganz Verrückter. Ich erinnerte mich an die beiden Küstenmotorschiffe. Sie liefen nicht viel schneller als ich und hatten mich gegen Abend draußen überholt. Die See ging so hoch, dass ich von meinem niedrigen Standort aus in den Wellentälern nicht viel mehr als ihre Mastspitzen sah. Von deck der Schiffe gesehen musste VAGANT wohl ein ziemlich spannendes Schauspiel geboten haben.
Der Hafen von Laboe war voll, dass ich nach kaum beendeter Nachtrufe hinauskomplimentiert wurde. Ich machte einen kurzen Abstecher in den Olympiahafen zur Passkontrolle und segelte wieder nach Strande.
Dort suchte ich erste einmal jemand, den ich für die nächtliche Panne kielholen konnte. Achselzuckend bekam ich zu hören, dass die eine der Positionslamoen des Hafens gerade in Reparatur sei. Und die andere? Na ja, die war dann eben mal ausgegangen, nicht weiter schlimm. Darauf konnte ich nur noch tief Luft holen und langsam vor mich hin zählen.
E gibt eben noch Leute mit sonnigen Gemütern.
Die große Reise war beendet. Insgesamt waren an 276 Reisetagen 420 reine Segelstunden zustande gekommen, mit Flaute und Sturm, hantigem Wind und müdem Hauch, in Regen, Sonnenschein und Nebel; hart gegen an knüppelnd, raumschoots und vor dem Wind waren 1162 Seemeilen zurückgelegt worden. Das entspricht einem Durchschnitt von 2,77 Knoten, bei deren Betrachtung man das völlige Versagen des Motors und die dadurch bedingten Flautenelemente berücksichtigen muss sowie durch das Klemmen des Schwertes von der Havarie bis zur Reparatur in Visby stark beeinträchtigten Kreuzeigenschaften.
Ein großes Erlebnis wurde Erinnerung. Nicht nur eine müde zurückschauende, sondern eine, die nach weit vorne weist zu neuen Fahrten mit Bewährung in Wind und See, wie wir sie brauche, um neue Kräfte für die Forderungen des Alltags zu gewinnen.
ENDE
Leider enthält dieser fotokopierte Bericht keine weiteren Fotos, als die in schwarz-weiß abgebildeten.
Zur Auflockerung würde ich gerne noch einige Bilder beifügen. Da ich selber noch nicht östlicher als Ystadt war, bin ich auf die Hilfe anderer Segler angewiesen, die mir vielleicht das ein oder andere Foto auf der Strecke bis Stockolm zur Verfügung stellen könnten.
Es wäre nett, wenn mir über diese Seite ein paar Fotos mit Ortsangabe zugemailt würden.
Die Farbfotos wurden mir von folgenden "usern" aus dem Yacht-Forum zur Verfügung gestellt:
1,2,3 und 4 von "Muckilein"
e-mail hier